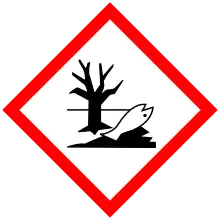Indol
Indol ist eine chemische Substanz aus der Gruppe der aromatischen, heterocyclischen Amine und kommt als Strukturfragment in vielen Naturstoffen vor.
| Strukturformel | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | ||||||||||||||||||||||
| Allgemeines | ||||||||||||||||||||||
| Name | Indol | |||||||||||||||||||||
| Andere Namen | ||||||||||||||||||||||
| Summenformel | C8H7N | |||||||||||||||||||||
| Kurzbeschreibung |
farblose Blättchen, die rein einen blumenartigen und verunreinigt einen unangenehmen Geruch besitzen[2] | |||||||||||||||||||||
| Externe Identifikatoren/Datenbanken | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||
| Molare Masse | 117,15 g·mol−1 | |||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand |
fest[2] | |||||||||||||||||||||
| Dichte |
1,22 g·cm−3 (20 °C)[3] | |||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt | ||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt |
254 °C[3] | |||||||||||||||||||||
| Dampfdruck | ||||||||||||||||||||||
| Löslichkeit |
schwer in Wasser (3,56 g·l−1 bei 25 °C)[3] | |||||||||||||||||||||
| Sicherheitshinweise | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Toxikologische Daten | ||||||||||||||||||||||
| Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. | ||||||||||||||||||||||
Geschichte
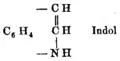
Die Indol-Chemie begann mit dem Studium des häufig verwendeten Farbstoffs Indigo. Indigo kann in Isatin und weiter zu Oxindol umgewandelt werden. 1866 reduzierte Adolf von Baeyer Oxindole mit Hilfe von Zinkstaub zu Indol.[5] 1869 schlug er eine Strukturformel für Indol vor.[6]
Bestimmte Indolderivate waren wichtige Farbstoffe bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. In den 1930er-Jahren stieg das Interesse an Indol, als bekannt wurde, dass Indol Grundbestandteil vieler wichtiger Naturstoffe wie Alkaloide (zum Beispiel Strychnin und Auxin) und der Aminosäure Tryptophan und von ihr abgeleiteter Neurotransmitter (Serotonin, Melatonin) ist. Es bleibt ein aktiver Bereich der Forschung bis heute.[7]
Vorkommen
Indol ist im Jasminblütenöl, Goldlacköl, aber auch in den Blüten der falschen Akazie und im Aronstab enthalten. In geringen Konzentrationen vermittelt Indol den typischen Blütenduft und wird daher auch Parfüms zugesetzt. In höheren Konzentrationen ist Indol, als Abbauprodukt der Aminosäure Tryptophan, neben Skatol (3-Methylindol), Ursache für den typischen Gestank von Fäkalien. Es ist ebenfalls in der bei 240 bis 260 °C siedenden Steinkohlenteer-Fraktion enthalten.
Indol ist Teil der proteinogenen Aminosäure Tryptophan.
Darstellung
Indol oder Indolderivate lassen sich auf verschiedene Arten darstellen. So unter anderem durch:
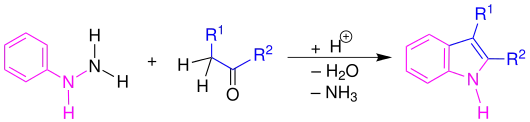
Verwendung
Indol ist Grundbaustein für Farbstoffe, Hormone und Alkaloide.
Der bekannteste vom Indol abstammende Farbstoff ist das Indigo, aber auch der antike Farbstoff Purpur. Das Hormon Melatonin (N-Acetyl-5-methoxytryptamin), der Neurotransmitter Serotonin (5-Hydroxytryptamin) sowie das Auxin Indol-3-essigsäure enthalten Indol als Strukturelement. Unter den Alkaloiden, die Indol enthalten, seien die Strychnos-Alkaloide (z. B. Strychnin und Brucin), die Mutterkornalkaloide (Ergotamin und sein synthetisches Derivat LSD), sowie der Pilzinhaltsstoff Psilocybin genannt. Zudem wird es für die Herstellung künstlicher Jasmin- und Neroliöle verwendet.
Eigenschaften
Indol ist schwach basisch, bildet aber mit Säuren kaum Salze; stattdessen reagiert es leicht zu harzigen Polymeren. Durch Alkalimetalle wird das NH-Proton abstrahiert. Bei elektrophilen Reaktionen reagiert bevorzugt der Pyrrol-Ring. Indol inhibiert die Enzyme Chymotrypsin, Lysozym und Tryptophanase.
Nachweis
Der Indol-Test wird bei der Identifizierung von Bakterien verwendet. Hierzu gibt man einen Tropfen Dimethylaminobenzaldehyd (Ehrlich-Reagenz, Kovacs-Reagenz) in das MIO-Röhrchen der Bunten Reihe, welches sich kirschrot verfärbt, wenn Tryptophan zu Indol abgebaut wurde.
Indolderivate
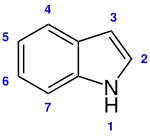
Es gibt zahlreiche Indolderivate, die in der Natur (Beispiel: Tryptophan), Technik (Beispiel: Indigo) und Pharmakologie (Beispiel: Indometacin) eine Rolle spielen.
Weblinks
Einzelnachweise
- Eintrag zu INDOLE in der CosIng-Datenbank der EU-Kommission, abgerufen am 30. Juni 2020.
- Eintrag zu Indol. In: Römpp Online. Georg Thieme Verlag, abgerufen am 20. Juni 2014.
- Eintrag zu Indol in der GESTIS-Stoffdatenbank des IFA, abgerufen am 20. Januar 2022. (JavaScript erforderlich)
- Datenblatt Indol (PDF) bei Merck, abgerufen am 5. September 2016.
- Baeyer, A.: Ueber die Reduction aromatischer Verbindungen mittelst Zinkstaub. In: Ann.. 140, 1866, S. 295. doi:10.1002/jlac.18661400306.
- Baeyer, A.; Emmerling, A.: Synthese des Indols. In: Chemische Berichte. 2, 1869, S. 679. doi:10.1002/cber.186900201268.
- R. B. Van Order, H. G. Lindwall: Indole. In: Chem. Rev.. 30, 1942, S. 69–96. doi:10.1021/cr60095a004.