Galopprennbahn Hoppegarten
Die Galopprennbahn Hoppegarten ist eine traditionsreiche, 1868 gegründete Pferderennbahn von 430 Hektar Fläche in Hoppegarten östlich von Berlin. Bis zum Ersten Weltkrieg entwickelte sich Hoppegarten zur wichtigsten deutschen Rennbahn und zum Treffpunkt des gesellschaftlichen und politischen Lebens Berlins und zog häufig bis zu 40.000 Zuschauer an. Nach der politischen Wende befanden sich die Anlage und der Rennbetrieb in einer schwierigen finanziellen Situation. Trotzdem konnten einige Rennen durchgeführt werden.[1] Im März 2008 übernahm ein Unternehmer die Rennbahn von der Treuhandanstalt und führte umfangreiche Renovierungen durch. Heute steht die Galopprennbahn unter Naturschutz und seit dem Jahr 2013 hat sie den Status als „national wertvolles Kulturdenkmal“.[2] Auch der Rennbetrieb verläuft seit 2008 wieder regelmäßig.[3] Pro Jahr finden bis zu elf Renntage statt, die auch internationale Rennställe anziehen.


Geschichte


Die Rennstrecke befindet sich auf einem Anbaugebiet für Hopfen aus der Zeit des preußischen Königs Friedrich Wilhelm I.
Aufstieg zur wichtigsten deutschen Rennbahn
Der Berliner Verein für Pferderennen suchte 1866 ein Gelände für den Bau einer neuen Rennbahn, denn die Pferderennbahn am Tempelhofer Exerzierplatz genügte den technischen und repräsentativen Ansprüchen nicht mehr. Das Vorwerk Hoppegarten, ein Nebenhof seines Gutes, verpachtete Heinrich von Treskow (1823–1886) 1866 an das Norddeutsche Union-Gestüt. Nachdem Hofstallmeister Fedor von Rauch König Wilhelm von Preußen von den Planungen für eine Galopprennbahn in Hoppegarten überzeugt hatte, wurde am 9. Oktober 1867 mit kurzfristig erbauten Holztribünen ein Proberenntag mit drei Jagdrennen auf dem Gelände durchgeführt, der zufriedenstellend verlief. So gründete sich am 15. Dezember 1867 mit 36 Mitgliedern aus ganz Deutschland der Union-Klub. Zu den Gründern gehörten Karl von Lehndorff, Johannes Maria von Renard, Ernst von Treskow, der Verleger und Sportjournalist Fedor André, August von Maltzan (Oberstallmeister), Victor I. Herzog von Ratibor und Hugo zu Hohenlohe-Öhringen. Fortan waren die Galopprennbahn und der Klub bis 1945 untrennbar miteinander verbunden.
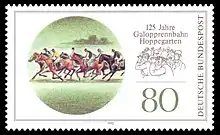
Die Finanzierung des Rennbahnbaus wurde durch Spenden der Klub-Mitglieder sowie Anteilscheine des Union-Gestüts und des Berliner Rennvereins gewährleistet. Der Berliner Baumeister Carl Bohm besuchte die Pferderennbahn Longchamp sowie die Rennbahn auf Schloss Chantilly und nahm sie als Vorbild für die Gestaltung der Hoppegartener Rennbahn. Im Frühjahr 1868 begannen die Erdarbeiten: Eine konsistente Humusschicht wurde auf den Sand aufgetragen, Bewässerungsrohre für den Rasen verlegt und eine Drainage für das Geläuf errichtet. Das Anlegen der 1200-Meter-Geraden trug zur späteren Popularität der Rennbahn bei. Gebaut wurden an einem Hindernis- und einem Flachkurs, der jedoch zur Einweihung noch nicht fertiggestellt war. Der preußische König Wilhelm I. und der Bundeskanzler des Norddeutschen Bundes Otto von Bismarck eröffneten am 17. Mai 1868 die Galopprennbahn Hoppegarten mit vier Hindernisrennen. Der Sieger im ersten, auf dieser Rennbahn ausgetragenen Rennen, dem Preis von Hoppegarten, war damals Leutnant von Bülow auf Missunde. Die Anreise zu diesem ersten Renntag war noch beschwerlich, da der Bahnhof Hoppegarten erst um 1870, unter anderen durch das Drängen des Union-Klub, errichtet wurde.
Seit der Eröffnung wurden wichtige Rennen in Hoppegarten ausgetragen. Die berühmtesten Rennen waren das seit 1868 stattfindende klassische Stutenrennen Preis der Diana (2000 Meter), seit 1871 das klassische Henckel-Rennen (1600 Meter) sowie das Union-Rennen und der Große Preis von Berlin (beide 2000 Meter). Mit den Einnahmen konnte der Klub 1874 für 296.000 Taler das Gelände von Treskow erwerben. Die Einführung des Totalisators (Toto) 1872 sicherte die Finanzierung der Rennen und ermöglichte 1886–1888 den Bau von massiven Tribünen anstelle der alten Holztribünen. Das Verbot der Wettmaschine von 1882 bis 1886 sowie das Sonntagsrennverbot von 1891 durch Wilhelm II. hemmten das Wachstum der Pferderennbahn. Doch die Aufhebung des Verbots im Jahr 1903, das neue Totogesetz von 1905 und die neue Rennordnung von 1912 begünstigten schließlich wieder die Entwicklung. Hoppegarten hatte sich zur wichtigsten deutschen Rennbahn entwickelt und war das Zentrum des gesellschaftlich-politischen Lebens Berlins geworden. Häufig sahen bis zu 40.000 Zuschauer die Rennen und bis zu 1000 Pferde standen in den Ställen in Hoppegarten und dem benachbarten Neuenhagen.
Auswirkung der Weltkriege

Mit Beginn des Ersten Weltkriegs wurde den britischen und amerikanischen Jockeys, die bisher die Rennszene dominiert hatten, die Teilnahme an Rennen in Hoppegarten verweigert.[4] Die meisten der amerikanischen Jockeys verließen Deutschland noch während des Krieges, während viele der britischen Staatsangehörigen, egal ob Trainer oder Jockey, zwischen 1914 und 1918 im Kriegsgefangenenlager in Ruhleben interniert wurden. Der Beliebtheit der Pferderennen tat dies keinen Abbruch, da nun durchweg deutsche Reiter die Siegerlisten füllten. Nach Ende des Krieges fanden auf Grund des Umbaus der Gebäude innerhalb der Rennbahn sowie der Umgestaltung der Anlage keine Rennen in Hoppegarten mehr statt, die Rennen in dieser Zeit hatte man auf die Rennbahn Grunewald verlegt. Im Jahr 1934, nach Aufgabe der Rennbahn in Berlin-Grunewald, wurde die Haupttribüne um einen seitlichen Anbau erweitert, sodass die Rennbahn 1935 beim Großen Preis die 45.000 Zuschauer fassen konnte. Die Weltwirtschaftskrise hatte auch dem Rennbetrieb und der Vollblutzucht Notzeiten beschert, doch am Ende der 1930er Jahre hatte sich die wirtschaftliche Lage in Hoppegarten wieder vollends stabilisiert.
Der Zweite Weltkrieg verschaffte Hoppegarten ein renommiertes Rennen mehr. Nach den Luftangriffen auf Hamburg im Jahr 1943 wurde das Derby hierher verlegt. Selbst 1944 fanden noch Pferderennen statt – allerdings mit wenig Besuchern und ohne den Totalisator und mit dementsprechend wenigen Einnahmen. Im Spätherbst 1944 wurde schließlich die Haupttribüne zu einer Rüstungsfabrik umfunktioniert. Im März 1945 begann der „große Treck“: Über 100 Vollblutpferde wurden von Jockeys innerhalb von drei Wochen nach Schleswig-Holstein geritten. Nahezu alle Pferde erreichten sicher das Ziel, viele wurden dann von der britischen Armee in Besitz genommen. Die in Hoppegarten verbliebenen Rennpferde wurden nach Kriegsende von den sowjetischen Truppen beschlagnahmt oder von der hungernden Bevölkerung geschlachtet.
Nischendasein mit „Volkseigenen Galoppern“
Bereits am 14. Juli 1946 wurde wieder ein offizielles Rennen in Hoppegarten geritten. Dazu war ein Großteil der verbliebenen, in ganz Deutschland verstreuten Rennpferde aufgestöbert worden. Allerdings fehlten zu den Tieren oft die Papiere, sodass ihre vollblütige Abstammung nicht mehr nachgewiesen werden konnte. Trotz dieser Bemühung herrschte von 1947 bis 1949 bei den Rennen ein chronischer Pferdemangel. 1950 waren es schließlich nur noch zwölf Pferde, die an den Start gingen, also erlaubte man kurzerhand als sogenannte „Bauernrennen“ auch die Teilnahme von Nicht-Vollblütern – bevorzugt Nutztiere aus der Landwirtschaft.
Der Union-Klub wurde 1946/1947 als Großgrundbesitzer durch die Bodenreform enteignet und die Rennbahn der Provinzialverwaltung Brandenburg unterstellt. 1952 ging das Eigentum in den Volkseigenen Rennbetrieb Hoppegarten über, 1974 übernahm der VEB Vollblutrennbahnen mit Sitz in Hoppegarten die Leitung aller Rennbahnen in der DDR. Der Zucht- und Rennbetrieb der DDR spielte international kaum eine Rolle und wurde von der Regierung wenig beachtet. Auch das Internationale Meeting der Vollblutpferde sozialistischer Länder, das zwischen 1954 und 1989 achtmal in Hoppegarten stattfand, konnte daran nichts ändern. Der Pferderennsport führte ein exotisches Nischendasein und sein Niveau sackte bis 1989 immer weiter ab.
Finanznöte nach der Wende und neue Zukunft

Am 31. März 1990 wurde der erste deutsch-deutsche Renntag mit großem Besucherandrang begangen – konkurrenzfähig war der ostdeutsche Pferderennsport jedoch nicht. Die Rennbahn stand in den ersten Jahren nach der Wende unter der Aufsicht der Treuhandanstalt. In den folgenden Jahren gab es mehrere Großereignisse wie Den großen Preis von Berlin, das BMW-Europa-Championat und die Berlin-Brandenburg-Trophy, gar Kamelrennen wurden veranstaltet. Der Wettumsatz betrug 1993 bereits wieder neun Millionen Mark (kaufkraftbereinigt in heutiger Währung: rund 7 Millionen Euro), doch die Rennbahn konnte an die erfolgreichen Zeiten vor den Weltkriegen trotzdem nicht anknüpfen.
Hoppegarten gelangte wieder in den Besitz des Union-Klubs, doch große Geldsummen waren zum Erhalt und Ausbau der Rennbahn nötig. Das Land Brandenburg stellte am 8. November 1999 für Investitionszwecke insgesamt fünf Millionen Mark zur Verfügung.[5] Der Union-Klub ging 2005 insolvent und die Galopprennbahn in den Besitz der Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH über. Der 2006 neu gegründete Rennverein Hoppegarten übernahm die Ausrichtung der Rennen für das Jahr 2007. Die ersten drei von zehn geplanten Renntagen mussten jedoch aus wirtschaftlichen Gründen abgesagt werden. Erst durch einen Zuschuss in Höhe von 150.000 Euro seitens der Gemeinde Hoppegarten wurde der Saisonbeginn möglich.[6]
Im März 2008 erwarb der Fondsmanager Gerhard Schöningh die Rennbahn – Hoppegarten ist damit die einzige Rennbahn in Europa, die komplett in privater Hand ist.[7] Die Rennbahn wurde schrittweise saniert und das Trainingszentrum ausgebaut. Seit 2008 finden wieder regelmäßig mehrere Renntage pro Jahr statt, an denen auch internationale Rennställe teilnehmen. Die Besucherzahlen der Rennbahn steigen ebenfalls.[8] Die Rennbahn ist heute fester Bestandteil des deutschen Galoppsports und hat sich an den Renntagen als Ausflugsziel für Familien aus Berlin und dem Umland etablieren können.[9] Am 21. Juli 2013 schrieb der 18-jährige Amateurrennreiter Dennis Schiergen auf Nymphea Rennsportgeschichte in Hoppegarten, als er den 123. Großen Preis von Berlin gewann.[10] Die Saison 2013 schloss die Rennbahn Hoppegarten erneut mit gestiegenen Besucherzahlen ab. Die Wettumsätze pro Renntag konnten 2013 auf dem Niveau des Vorjahres gehalten werden.[11] Bis 2015 konnten die Besucherzahlen im Vergleich zu 2008 verdoppelt werden, die Wettumsätze stiegen um 80 % pro Rennen.
Siehe auch
Literatur
Grundlage dieses Artikels sind die nachstehend aufgeführten Bücher sowie der Artikel im Tagesspiegel. Alle Angaben – wie Kosten und Besucherzahlen – wurden, soweit nicht abweichend durch Einzelnachweise angegeben, übereinstimmend aus diesen Veröffentlichungen entnommen.
- Horst Seyfarth: Hoppegarten. Deutschlands schönste Galopprennbahn. Verlag Neues Leben, Berlin 1993, ISBN 3-355-01378-1.
- Thomas Krüger: Hoppegarten. Geschichte einer Rennbahn. Ullstein, Berlin 1994.
- Gerd von Ende: Berliner Rennfieber – Galopp und Trab zu 150 Jahren Hoppegartener Turf, Verlag tredition, Hamburg, 2018.
- Hoppegarten: Vom Kaiser bis zum Themenpark. In: Der Tagesspiegel. 24. März 2001, abgerufen am 26. November 2014.
Weblinks
- Offizielle Webpräsenz des Rennvereins Hoppegarten
- Walther F. Kleffel: Eine geschlossene Gesellschaft von Gentlemen. 100 Jahre Union-Klub. In: Die Zeit. 25. August 1967, abgerufen am 4. Februar 2014.
- Hoppegarten bietet 2013 mehr Klasse auf der Rennbahn. In: Berliner Morgenpost. 20. April 2013, abgerufen am 4. Februar 2014.
- Stefan Willeke: Lauf, Mister Detective, lauf. In: Der Spiegel. 1/2014, 30. Dezember 2013, S. 88 ff., abgerufen am 4. Februar 2014.
Einzelnachweise
- Ascot liegt gleich bei Hoppegarten. In: Die Welt, 6. August 1999, abgerufen am 2. Mai 2020.
- Rennbahn Hoppegarten in Denkmalförderprogramm aufgenommen. Bei: hoppegarten.com, abgerufen am 2. Mai 2020
- Prince Flori triumphiert in Hoppegarten. In: Berliner Morgenpost, 3. Oktober 2008, abgerufen am 2. Mai 2020
- Berlin turns to Racing, Crowd Applauds Victories of an American Jockey. In: The New York Times, 26. Mai 1915, abgerufen am 10. Februar 2013
- Rechnungshofbericht zu Hoppegarten (Memento vom 29. November 2014 im Internet Archive) vom 20. Dezember 2006.
- Manuel Holscher: Erleichterung in Hoppegarten. Morgen erster Galopprenntag des Jahres mit 74 Pferden in acht Wettbewerben. In: Berliner Morgenpost. 26. Mai 2007; abgerufen am 17. Juli 2007.
- Galopprennbahn Hoppegarten verkauft. In: Welt Online. 18. März 2008; abgerufen am 2. April 2008.
- 2012 insgesamt 74.100 Zuschauer in Hoppegarten. In: Märkische Oderzeitung. 29. November 2012; abgerufen am 19. Februar 2013.
- Die neue Nähe zu Hoppegarten. In: Berliner Zeitung. 19. April 2013; abgerufen am 7. Mai 2013.
- Großer Preis von Berlin in Hoppegarten – Die Ausreißer siegen. In: Der Tagesspiegel. 21. Juli 2013; abgerufen am 29. Juli 2013.
- Positive Saisonbilanz 2013 – Rennbahn Hoppegarten setzt auf Wiederholungstäter (Memento vom 2. Februar 2014 im Internet Archive) Bei: Rundfunk Berlin-Brandenburg. 29. November 2013; abgerufen am 4. Dezember 2013.