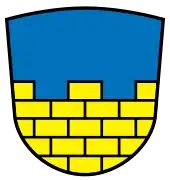Pulsnitz
Pulsnitz (obersorbisch Połčnica) ist eine sächsische Kleinstadt im Landkreis Bautzen am westlichen Rand der Oberlausitz, etwa 10 km südlich von Kamenz und rund 25 km nordöstlich der Landeshauptstadt Dresden. Pulsnitz ist Sitz der Verwaltungsgemeinschaft Pulsnitz.
| Wappen | Deutschlandkarte | |
|---|---|---|
 |
| |
| Basisdaten | ||
| Bundesland: | Sachsen | |
| Landkreis: | Bautzen | |
| Verwaltungsgemeinschaft: | Pulsnitz | |
| Höhe: | 290 m ü. NHN | |
| Fläche: | 26,76 km2 | |
| Einwohner: | 7433 (31. Dez. 2020)[1] | |
| Bevölkerungsdichte: | 278 Einwohner je km2 | |
| Postleitzahl: | 01896 | |
| Vorwahl: | 035955 | |
| Kfz-Kennzeichen: | BZ, BIW, HY, KM | |
| Gemeindeschlüssel: | 14 6 25 450 | |
| Stadtgliederung: | 4 Ortsteile | |
| Adresse der Verbandsverwaltung: | Am Markt 1 | |
| Website: | ||
| Bürgermeisterin: | Barbara Lüke (parteilos) | |
| Lage der Stadt Pulsnitz im Landkreis Bautzen | ||
 Karte | ||
Überregional bekannt ist Pulsnitz als Pfefferkuchenstadt.
Geografie
Geografische Lage

Die Altstadt liegt auf einer Anhöhe oberhalb des Pulsnitztals, der gleichnamige Fluss (die Pulsnitz) entspringt im Nachbarort Ohorn. Die kleine Stadt liegt eingebettet in die Hügelketten des Westlausitzer Hügel- und Berglandes (bis 448 m). Die Bergkuppen sind größtenteils bewaldet.
Nachbargemeinden
Angrenzende Gemeinden sind (im Uhrzeigersinn) Haselbachtal, Steina, Ohorn, Großröhrsdorf, Lichtenberg und Großnaundorf.
Stadtgliederung
Zur Stadt Pulsnitz gehört neben der Stadt nur ein ausgewiesener Ortsteil im Sinne der Sächsischen Gemeindeordnung: Oberlichtenau. Die Stadt Pulsnitz war bis 1948 zweigeteilt: Die Stadt Pulsnitz, Oberlausitzer Seite mit der Vollung und das Dorf Pulsnitz, Meißner Seite. Friedersdorf, bis dahin selbständig, wurde 1994 in die Stadt ohne eigenen Ortschaftsstatus eingemeindet. Umgangssprachlich werden neben Friedersdorf gelegentlich 3 Siedlungen als eigene Ortsteile bezeichnet, ohne dass sie diesen Status im Sinne der Sächsischen Gemeindeordnung tatsächlich haben: Friedersdorf Siedlung, Pulsnitz Feldschlößchensiedlung (ehmels Otto-Buchwitz-Siedlung) und Pulsnitz Mittelbacher Siedlung.
Geschichte
_216a.jpg.webp)

Pulsnitz wurde, wie viele andere Orte der Oberlausitz auch, am 19. Mai 1225 erstmals urkundlich erwähnt, und zwar als Polseniz. Bereits vorher hatte sich hier eine sorbische Siedlung mit Wasserburg entwickelt. Pulsnitz wurde Sitz einer adligen Familie, die sich hier ein kleines Schloss bauen ließ.
Der aus dem Sorbischen stammende Ortsnamen leitet sich vom gleichlautenden Gewässernamen ab, der von Ernst Eichler und Hans Walther auf altsorbisch *Połźnica, von *połz- („kriechen“) zurückgeführt wird und soviel wie „kriechendes (langsam fließendes) Gewässer“ bedeutet.[2]
1355 erhielt Polßnitz von Kaiser Karl IV. das Marktrecht, nur 20 Jahre später (1375) das Stadtrecht. Anfang des 15. Jahrhunderts verwüsteten die Hussiten die Oberlausitz. Auch in Pulsnitz fielen die Hussiten 1429 ein (nicht zum ersten Mal). Aus dieser Zeit stammt die älteste bäuerliche Befestigungsanlage Perfert. Um 1500 herum begannen die Bauarbeiten für das Pulsnitzer Rathaus, dessen Reste heute noch im Ratskellergebäude zu sehen sind.

Am 1. Januar 1558 erhielten die Pulsnitzer Bäcker erstmals das Recht, auch Pfefferkuchen zu backen. 1580 erwarb Hans Wolf von Schönberg Pulsnitz mit seinen Pertinenz-Orten von den Gebrüdern von Schlieben. Er entzog dem Rat die Niedere Gerichtsbarkeit und versuchte, die Bürger zu zwingen, Malz und andere notwendige Dinge nur noch bei ihm zu kaufen. Sie beschwerten sich beim Kaiser und verübten sogar einen Mordanschlag gegen Schönberg. Auch der Pfarrer A. Ricchius (Sohn des ersten protestantischen Pfarrers der Stadt Andreas Ricchius) solidarisierte sich mit den Bürgern und wurde entlassen.
1869 wurde Pulsnitz an die neu gebaute Eisenbahnstrecke Arnsdorf–Pulsnitz–Kamenz angeschlossen. In der Folgezeit begann ein industrieller Aufschwung. Zum Ende des Zweiten Weltkrieges 1945 blieb die Stadt trotz schwerer Kampfhandlungen in der Oberlausitz weitestgehend unversehrt.
Eingemeindungen
Die ehemalige Gemeinde Pulsnitz, Meißner Seite wurde am 1. April 1948 eingegliedert.[3] Am 1. Januar 1994 wurde die bis dahin selbstständige Gemeinde Friedersdorf mit Friedersdorf Siedlung eingemeindet.[4] Am 1. Januar 2009 folgte die ehemalige Nachbargemeinde Oberlichtenau.[5] Das Stadtgebiet vergrößerte sich durch diese letzte Eingliederung von 16,69 km² auf 26,72 km².

Einwohnerentwicklung
Entwicklung der Einwohnerzahl (ab 1960 31. Dezember):
|
|
|
|
- Datenquelle ab 2000: Statistisches Landesamt Sachsen
Wappen
Beschreibung: In Gold eine schwarze Bärentatze.
Politik
Gemeinderat
Seit der Gemeinderatswahl am 26. Mai 2019 verteilen sich die 17 Sitze des Stadtrates folgendermaßen auf die einzelnen Gruppierungen:
| Liste | CDU | FDP | AfD | ABW* | LINKE | Grüne | SPD |
| Sitze 2019 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitze 2014 | 6 | 5 | ― | 3 | 2 | ― | 1 |
* Aktive Bürger Wählervereinigung
Städtepartnerschaft
Partnerstadt von Pulsnitz ist Złotoryja (Goldberg) in der polnischen Woiwodschaft Niederschlesien.[8] Freundschaftliche Kontakte bestehen zu Asperg in Baden-Württemberg.[9]
Kultur und Sehenswürdigkeiten
Museen
- Das Stadtmuseum informiert über die Geschichte und berühmte Persönlichkeiten der Stadt.
- Im Pfefferkuchenmuseum können in einer Schauwerkstatt selbst Pfefferkuchen gebacken werden.
- In der Galerie im Hans-Rietschel-Haus zeigt der Ernst-Rietschel-Kulturring e.V. wechselnde Kunstausstellungen.
- Weitere Ausstellungen finden in der ostsächsischen Kunsthalle statt, die ebenfalls vom Rietschel-Kulturring getragen wird.
Bauwerke
 Wehranlage Perfert
Wehranlage Perfert Marktplatz
Marktplatz Denkmal Ernst Rietschel
Denkmal Ernst Rietschel Kursächsische Postdistanzsäule
Kursächsische Postdistanzsäule Kirche St. Nicolai
Kirche St. Nicolai Pfützner-Orgel der St.-Nikolai-Kirche
Pfützner-Orgel der St.-Nikolai-Kirche
- Bäuerliche Wehranlage Perfert (auch Hussitenhaus) aus der Zeit um 1420
- Mittelalterlicher Marktplatz mit Rathaus und Denkmal für den Bildhauer Ernst Rietschel
- Kursächsische Postdistanzsäule als Nachbildung vor dem Schützenhaus (Originalschriftblock und Wappen von 1731 im Rathaus)
- Altes Renaissance- und neues Barockschloss Oberlichtenau (1718) mit Park im englisch-französischen Stil
- Spätgotische Kirche St. Nicolai mit Pfützner-Orgel
- Bibelgarten mit Miniatur-Nachbau einer byzantinischen Basilika in Oberlichtenau
Berge und Aussichtspunkte
- Wenige Kilometer östlich von Pulsnitz nahe der Gemeinde Steina liegt der Schwedenstein, ein 420 m hoher Berg, dessen Aussichtsturm einen guten Rundumblick über die Westlausitzer Hügelketten bietet.
- Rund sechs Kilometer nordwestlich des Stadtzentrums liegt auf dem Gebiet des Pulsnitzer Stadtteils Oberlichtenau der 413 m hohe Keulenberg, der ebenfalls ein Wanderziel darstellt und eine gute Aussicht bietet.
- In Richtung Radeberg liegt der Eierberg.
Kulinarische Spezialitäten
Pulsnitz ist weit bekannt als Pfefferkuchenstadt. Neben vielen weiteren Sorten sind die Pulsnitzer Spitzen eine besondere Spezialität. Es ist ein mit verschiedenen Konfitüren gefüllter Pulsnitzer Pfefferkuchen, welcher zusätzlich mit Schokolade überzogen wurde.
Wirtschaft und Infrastruktur
Verkehr


Pulsnitz liegt drei Kilometer nördlich der Bundesautobahn 4. Durch den Ort verläuft die Staatsstraße 95, die auch zur Anschlussstelle Pulsnitz bei Leppersdorf führt.
Durch Pulsnitz führt die Bahnstrecke Kamenz–Pirna, die von der S-Bahn-Linie S8 Dresden – Radeberg – Kamenz im Stundentakt an den Haltestellen Pulsnitz und Pulsnitz Süd bedient wird. In der Hauptverkehrszeit verkehrt diese Linie halbstündlich.
Vom Pulsnitzer Bahnhof aus fahren ebenfalls verschiedene Regionalbuslinien (Stand 30.08.2021):
| Linie | Verlauf |
|---|---|
| 170 | Pulsnitz – Oberlichtenau – Reichenbach – Häslich – Kamenz |
| 304 | Pulsnitz – Ohorn – Bretnig – Großröhrsdorf |
| 306 | Pulsnitz – Ohorn – Bretnig |
| 309 | Pulsnitz – Leppersdorf – Radeberg – Dresden-Bühlau – Dresden-Blasewitz |
| 311 | Pulsnitz – Höckendorf – Königsbrück |
| 312 | Pulsnitz – Oberlichtenau – Reichenbach – Reichenau – Königsbrück |
| 315 | Pulsnitz – Steina – Ohorn |
| 316 | Großröhrsdorf – Pulsnitz – Steina – Möhrsdorf – Gersdorf – Kamenz/Bischheim |
Ansässige Unternehmen
Der Ort ist seit je her geprägt durch kleinere und mittelständische Unternehmen im produzierenden und Handels-Bereich. Vor allem Töpfer (Lausitzer Keramik), Tuchdrucker (Blaudruck) und die zurzeit acht privaten Pfefferküchlereien und eine Lebkuchenfabrik prägten und prägen das Bild der Stadt. Ein Schwarzwälder Traditionsunternehmen ließ hier öl- und gasbeheizte Backöfen bauen. Im Jahre 2000 wurde die Produktion von der Hildener Firma Wachtel übernommen.
Zwei private Rehakliniken machen Pulsnitz zu einem wichtigen Medizinstandort, eine Klinik ist im Schloss untergebracht.
Medien
Das amtliche Mitteilungsblatt ist der Pulsnitzer Anzeiger. Als Heimatzeitung für Pulsnitz und Umgebung erscheint es seit Juli 1990 monatlich in einer Auflagenhöhe von derzeit 6.500 Exemplaren[10]. Über das örtliche Fernsehkabelnetz kann zudem die Pulsnitzer Kabelzeitung empfangen werden.
Bildung
In Pulsnitz befinden sich eine Grundschule und eine Oberschule (Ernst-Rietschel-Oberschule), im Ortsteil Oberlichtenau befindet sich ebenfalls eine Grundschule. Das nächstgelegenste Gymnasium ist das Ferdinand-Sauerbruch-Gymnasium in Großröhrsdorf.
Persönlichkeiten
Söhne und Töchter der Stadt

- 1561: Balthasar Kestner, fürstlich-schaumburgischer Hofschneider, Kämmerer und Ratsherr zu Bückeburg
- 1682: Bartholomäus Ziegenbalg, erster protestantischer Missionar und indischer Sprachforscher
- 1785: Christian Gottlob Eißner, evangelisch-lutherischer Pfarrer und Autor
- 1802: Karl Eisner, Musiker und Komponist
- 1804: Ernst Rietschel, einer der bedeutendsten Bildhauer seiner Zeit.
Er schuf so bekannte Denkmäler wie das Goethe-Schiller-Denkmal in Weimar. Das Rietschel-Denkmal auf dem Marktplatz wurde von seinem Schüler Gustav Kietz entworfen und umgesetzt. - 1825: Julius Kühn, bedeutender Agrarwissenschaftler, er begründete das erste landwirtschaftliche Institut an einer deutschen Universität.
- 1840: Alwin Hartmann, Reichstagsabgeordneter und Landgerichtspräsident in Plauen
- 1847: Georg Hempel, Unternehmer, Reichstags- und Landtagsabgeordneter
- 1851: Walther Hempel, Chemiker, Mitbegründer der technischen Gasanalyse
- 1869: Alwin Peschke, Komponist, Kapellmeister des 2. Garde Dragoner-Regiments in Berlin von 1900 bis 1918 (Obermusikmeister) und Kornettist
- 1879: Rudolf Stempel, Pfarrer, Märtyrer der Evangelischen Kirche
- 1897: Curt Haase, Politiker (NSDAP)
- 1908: Robert Johannes Classen, Kaufmann und Astronom
- 1932: Günter Haase, Geograph
- 1933: Klaus Thielmann, Medizin-Professor, DDR-Gesundheitsminister in der Regierung Modrow
- 1938: Klaus Staeck, Grafiker
- 1939: Hartmut Bonk, Bildhauer und Graphiker, ab 1988 Professor an der Hochschule für Bildende Künste in Berlin-Charlottenburg.
Weitere Persönlichkeiten
- Max Schreyer (1845–1922), Oberforstrat, Dichter des Liedes Dar Vuglbärbaam, verbrachte seine letzten Lebensjahre in Pulsnitz.
- Hulda von Levetzow (1863–1947), Autorin, verbrachte ihre letzten Lebensjahre in Pulsnitz.
- Hermann Linke (1866–1925), Gewerkschafter, Pulsnitzer Geschäftsführer des Textilarbeiterverbandes, Abgeordneter des Sächsischen Landtags.
- Erich Stange (1888–1972), evangelischer Pfarrer in Pulsnitz, Reichswart der Evangelischen Jungmännerbünde und einer der Begründer der Telefonseelsorge in Deutschland.
- Roswitha Neubarth (1928–2010), Komponistin.
Literatur
- Roland Kahle/Rüdiger Rost: Pulsnitz – Als die Schornsteine noch rauchten. Fotodokumente zwischen 1945 und 1989. Leipziger Verlagsgesellschaft, Leipzig 2008, ISBN 9783910143784.
- Rüdiger Rost, Horst Oswald: Geschichte der Stadt Pulsnitz. Von den Anfängen bis zum Jahr 2000. Oberlausitzer Verlag, Spitzkunnersdorf 2000, ISBN 3-933827-14-0.
- Werner Schmidt/Dietrich Zühlke (Bearb.): Lausitzer Bergland um Pulsnitz und Bischofswerda (= Werte unserer Heimat. Band 40). Akademie Verlag, Berlin 1983.
- Cornelius Gurlitt: Beschreibende Darstellung der älteren Bau- und Kunstdenkmäler des Königreiches Sachsen. 36. Heft: Die Städte Kamenz und Pulsnitz. C.C. Meinhold & Söhne, Dresden 1912, S. 228–275.
Einzelnachweise
- Bevölkerung des Freistaates Sachsen nach Gemeinden am 31. Dezember 2020 (Hilfe dazu).
- Ernst Eichler, Hans Walther: Historisches Ortsnamenbuch von Sachsen. Band II (M–Z), Akademie-Verlag, Berlin 2001, S. 230
- Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Gemeinden 1994 und ihre Veränderungen seit 1. Januar 1948 in den neuen Ländern. Metzler-Poeschel, Stuttgart 1995, ISBN 3-8246-0321-7.
- StBA: Änderungen bei den Gemeinden Deutschlands, siehe 1994
- StBA: Gebietsänderungen am 01.01.2009
- Pulsnitz im Digitalen Historischen Ortsverzeichnis von Sachsen
- Statistik Sachsen: Ergebnisse der Gemeinderatswahl 2019 in Pulsnitz, abgerufen am 25. Juli 2019
- Website Stadt Pulsnitz (Memento des Originals vom 10. Juni 2016 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
- Website Stadt Asperg (Memento des Originals vom 16. Juli 2014 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
- Pulsnitzer Anzeiger 2021. Abgerufen am 11. Februar 2022.
Weblinks
- www.pulsnitz.de
- Pulsnitz im Digitalen Historischen Ortsverzeichnis von Sachsen
- Pulsnitz, Meißner Seite im Digitalen Historischen Ortsverzeichnis von Sachsen