Westerwälder Braunkohlerevier
Das Westerwälder Braunkohlerevier ist ein Bergbaurevier im Westerwald, in dem vom 16. bis ins 20. Jahrhundert[1] Braunkohle gewonnen wurde. Der Schwerpunkt der Lagerstätten liegt im Hoch- und Oberwesterwald um Westerburg und Bad Marienberg (Rheinland-Pfalz)[2] sowie weiter östlich bei Breitscheid[3] (Hessen).


(als Industriedenkmal in Höhn aufgestellt)
Das Braunkohlerevier überschneidet sich geographisch mit Abbaugebieten anderer Bodenschätze, insbesondere Basalt, Quarzit, Ton und Eisenstein. Letztere Lagerstätten gehören zum Siegerländer Erzrevier. In einigen Fällen wurden Ton und Braunkohle aus derselben Grube gefördert.
Entstehung und geologischer Hintergrund
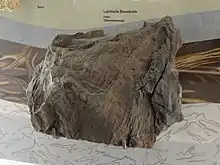
(Deutsches Bergbau-Museum Bochum)
Die Braunkohlevorkommen des Westerwaldes entstanden im Miozän (vor etwa 26 bis 9 Millionen Jahren[2]), als sich in Einsenkungen in der Basalthochfläche des Hohen Westerwaldes Sümpfe und Moore bildeten.[4] Unter und zwischen den Braunkohleflözen liegen sandige und tonige Schichten aus der Verwitterung von Grauwacke und Schiefer.[4] Teilweise sind die kohleführenden Schichten wiederum durch eine Decke aus Basaltgestein überlagert.[5]
Im Westerwald lassen sich zwei Arten von Braunkohle unterscheiden:[1]
- Weichbraunkohle: Diese Kohle ist aufgrund des geringen Alters wenig inkohlt. Die Konsistenz ist weich, faserig und torfartig („Moorkohle“). Der Wassergehalt ist sehr hoch (bis etwa 50 %),[6] der Heizwert entsprechend gering. Da die Kohle wegen ihrer geringen Festigkeit leicht zu „Kohlenklein“ (Grus) zerfiel, wurde sie zur besseren Handhabung mit Lehm vermischt, zu Ballen geformt und an der Sonne getrocknet.[1]
- Hartbraunkohle: An einigen Orten, insbesondere dort, wo die Flöze durch vulkanisches Deckgebirge aus Basalt überlagert wurden (beispielsweise in der Grube Alexandria), ist die Kohle lignitisch, eichenholzartig[7] und teilweise so hart, dass der Vortrieb durch Schießen (Sprengen) erfolgen musste.[1] Durch den geothermischen Einfluss des Vulkangesteins trat eine erhebliche Beschleunigung der Inkohlung ein. Die Kohle hat einen – für eine so junge Braunkohle – ungewöhnlich geringen Wassergehalt von etwa 30-35 %,[6] und dadurch einen hohen Heizwert. Dank der festen Konsistenz konnte die Kohle in stückiger Form transportiert und verarbeitet werden.
Geologisch verwandt mit den Braunkohlevorkommen ist die als Fossilienfundplatz bekannte Ölschieferlagerstätte Stöffel bei Enspel.[8][5]
Geschichte
Anfänge (16. bis 18. Jahrhundert)
Erste Berichte über Kohlevorkommen im Westerwald reichen bis ins 16. Jahrhundert zurück. An Hängen, wo Flöze an die Oberfläche ausbissen, und in darunterliegenden Bach- und Flussbetten fand man Braunkohlestückchen,[1] und auch in Steinbrüchen war man beim Abbau auf „unterirdisches Holz“ gestoßen.[2] Wegen der holzartigen Struktur wurde die lignitische Kohle auch „Holzkohle“ genannt (siehe Kartenausschnitt unten) – nicht zu verwechseln mit in Meilern verkohltem Holz. Da zu dieser Zeit der Brennstoffbedarf durch Holz gedeckt wurde, blieb die Kohle zunächst ungenutzt.[2]
Mitte des 17. Jahrhunderts wurde unter Fürst Johann Ludwig von Nassau-Hadamar bei Höhn ein erster Versuch unternommen, Kohle aus einer Grube zu gewinnen; wegen Problemen mit der Wasserhaltung,[1] und da die Kohle nicht die erhoffte Qualität aufwies,[2] wurde das Vorhaben bald wieder aufgegeben.
Im 18. Jahrhundert stieg mit dem Einsetzen der Industrialisierung und dem Wachstum der Eisenhütten im Siegerland der Brennstoffbedarf deutlich an, und man machte sich auch im Westerwald auf die Suche nach Kohle. Dabei wurde man an verschiedenen Stellen fündig, etwa bei Höhn, Schönberg, Bach und Stockhausen.[9] Da es sich bei der gefundenen Kohle aber nicht wie erhofft um hochwertige Steinkohle, sondern durchweg nur um Braun- und Moorkohle handelte, die – wie Versuche zeigten – für die Eisenverhüttung ungeeignet war, blieben die Nutzungsmöglichkeiten gering und der wirtschaftliche Erfolg des Kohlebergbaus zunächst aus.[1][2][10] Die minderwertige Kohle wurde überwiegend von der niederen Landbevölkerung als Hausbrand verwendet.[1] Auch wurde diese Kohle auf Wiesen und Äckern verbrannt und ihre Asche als Dünger verteilt.[1] Die Gruben dieser Zeit waren überwiegend kleine Kuhlen an der Erdoberfläche, die mit einfachen Werkzeugen gegraben wurden; selten nur wurden kurze Stollen angelegt. Eindringendes Grubenwasser wurde durch oberirdische Gräben („Röschen“) abgeführt.
Wachstum und Blüte (19. bis 20. Jahrhundert)
.jpg.webp)
Im Laufe des 18. und 19. Jahrhunderts wurden Holz und Steinkohle immer knapper und teurer, wodurch die Braunkohle als Alternative wirtschaftlich zunehmend konkurrenzfähig wurde. Immer mehr bedienten sich nun auch Handwerk und Gewerbe (Bäcker, Bierbrauer, Branntweinbrennereien, Essigfabriken, …) des billigen Brennstoffes.[2] Um die Verbrennungseigenschaften zu verbessern, wurde die Kohle teilweise in Meilern – ähnlich wie Holz zu Holzkohle – „verkohlt“. In dieser veredelten Form und in Mischung mit Steinkohle war die Braunkohle auch von Betrieben nutzbar, die einen höheren Heizwert benötigten, wie etwa Schmieden, Schlossereien und vereinzelt sogar Eisenhütten.[1]
Mit der zunehmenden Nachfrage stieg auch der Preis der Braunkohle und in der Folge die Zahl der aufgefahrenen Bergwerke. Mitte des 19. Jahrhunderts gab es bereits 22 Bergwerke, die jährlich etwa 50.000 Tonnen Kohle förderten. Zudem ging man immer mehr dazu über, die höherwertige, tieferliegende Hartbraunkohle im Untertagebau mittels Stollen, Schächten und Strecken zu gewinnen.
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kam es zu einer Konzentration: Kleine, ausgekohlte und unwirtschaftliche Gruben wurden geschlossen, die verbleibenden wurden organisatorisch und baulich zusammengeschlossen. Die Zahl der Gruben wuchs kaum, ging zeitweise sogar zurück, die Zahl der beschäftigten Bergleute und die geförderte Kohlemenge stieg aber deutlich an.
Ende des 19. Jahrhunderts führten Massenstreiks im Ruhrrevier zu einer Verknappung von Steinkohle und zu einem deutlichen Nachfrage- und Preisanstieg bei der Braunkohle. Von diesem profitierte – wenn auch nicht so stark wie andere Braunkohlereviere – auch das Westerwälder Revier beträchtlich.
Der Bau der Westerwaldquerbahn im Jahr 1906, an die in der Folge fast alle großen Gruben angeschlossen wurden, verbesserte die Transport- und Vertriebswege und damit die Absatzmöglichkeiten der Westerwälder Kohle, jedoch nicht so stark wie zuvor erhofft.
Im Jahr 1914 eröffnete die Elektrizitätswerk Westerwald AG (EWAG), der mit der Grube Alexandria in Höhn das größte Bergwerk des Reviers gehörte, neben der Grube ein Elektrizitätswerk, welches bald zum Hauptabnehmer der minderwertigen Westerwälder Braunkohlen wurde,[11] sowie eine Dampfziegelei.[11]
Niedergang (20. Jahrhundert)
Trotz der genannten Verbesserungen blieb das Westerwälder Revier gegenüber den rasant wachsenden deutschen Steinkohlerevieren (insbes. dem Ruhrrevier) und auch gegenüber dem nahegelegenen Rheinischen Braunkohlerevier in der wirtschaftlichen Entwicklung zurück. Im Vergleich zur Steinkohle waren die Verwendungsmöglichkeiten der Westerwälder Braunkohle zu eingeschränkt; erneute Versuche, die Kohle in der Eisenverhüttung oder zur Verschwelung zu verwenden, waren gescheitert.[1] Im Vergleich zum anderen deutschen Braunkohlerevieren, wo die Kohle kostengünstig im Tagebau gewonnen werden konnte, war der untertägige Abbau im Westerwald weit aufwändiger und teurer.
Zwar trat vor und nach dem Ersten Weltkrieg nochmals ein ähnlich positiver Effekt wie nach den Streiks von 1889 ein, als zunächst der große Bedarf der Rüstungsindustrie und später die fälligen Reparationslieferungen sowie die Besetzung des Rheinlandes und des Ruhrgebietes die Preise für Kohle in die Höhe trieben.[2] Der dadurch bewirkte Aufschwung war aber nur von kurzer Dauer: Die Wirtschaftskrise ab Ende der 1920er-Jahre führte zu einem dramatischen Einbruch der Nachfrage und zu einem Verfall der Preise. Die Westerwälder Kohle konnte gegen das Überangebot an billiger Rheinischer Braunkohle und hochqualitativer Ruhrsteinkohle nicht bestehen. Binnen weniger Jahre wurden fast alle Gruben geschlossen. 1940 waren im ganzen Revier nur noch vier aktive Braunkohlegruben übrig.[2] Der Zweite Weltkrieg brachte den Abbau dann vorübergehend fast vollständig zum Erliegen.
In der Nachkriegszeit zog die Nachfrage nach Kohle wegen des Wiederaufbaus der Industrie und das einsetzende Wirtschaftswunder wieder an, und der Abbau in der Grube Alexandria wurde wieder verstärkt. Kurzzeitig kam es auch zu „wilder“ Kohlengräberei in kleinen Kuhlen; diese wurde aber von Seiten der Bergaufsicht bald unterbunden.[1] Auch gab es einen erneuten Versuch, den Abbau nach dem Vorbild der großen deutschen Braunkohlereviere mit Großgeräten im Tagebauverfahren zu betreiben. Hierfür wurde in Marienberg am Bacher Lay mit einem 45-Tonnen-Bagger (Typ Menck) der Tagebau Neuhaus II aufgeschlossen. Dieser stellte aber bereits nach wenigen Monaten wegen Unwirtschaftlichkeit den Betrieb ein.[1]
Ab 1954 war als letzte verbliebene Grube des Westerwälder Braunkohlereviers nur noch die Schachtanlage Alexandria mit dem angeschlossenen Kraftwerk in Betrieb. Als 1959, nach mehreren Eigentümerwechseln in schneller Folge, die Stilllegung des Kraftwerks in Höhn beschlossen wurde und somit der Hauptabnehmer der Kohle wegfiel, war auch das Ende des Bergbaus absehbar.[11] Etwa zwei Jahre später, im Frühjahr 1961, wurde der Betrieb des letzten Bergwerkes eingestellt.[12]
Erhaltene Reste
Heute erinnern nur noch Spuren an die langjährige Geschichte des Braunkohlebergbaus im Westerwald:
- einige in Ortschaften als Denkmal aufgestellte Fördergerüste und Geräte, z. B. in Höhn (von Grube Alexandria, siehe Bild), Norken (von Grube Späth)[13] und Kaden (von Grube Anna)[14]
- einige erhaltene Verwaltungs- und Betriebsgebäude, z. B. das der Grube Anna[14] in Kaden oder die Ruine des Kraftwerks in Höhn
- zahlreiche Pingen und Bergehalden im Bereich der ehemaligen Grubengelände
Liste von Bergwerken
Die folgende unvollständige Liste enthält Bergwerke des Westerwälder Braunkohlereviers.[1][15]
Ebenfalls sind diese, mit Ausnahme von Niederdresselndorf (Concordia) und Emmerzhausen (Adolfsburg), dem Bergrevier Dillenburg zugehörig:
| Verbandsgemeinde (in RP), Kreis (Land) |
Gemeindegemarkung | Name des Bergwerks (Grube, Zeche) |
Genauere Lagebeschreibung | Betriebsdauer | Bemerkung / Quellen | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Siegen-Wittgenstein (NRW) |
Burbach | Concordia | bei Niederdresselndorf | 1841–1857 | Stollen[16] | |
| Lahn-Dill-Kreis (Hessen) |
Breitscheid | Phönix-Glückauf (Ludwigs Zuversicht) |
am westlichen Ortsrand von Breitscheid (50° 41′ 6,8″ N, 8° 10′ 51,9″ O)[17] |
1762–1953[18] | Betreiber: ab 1900 Westerwälder Thonindustrie in Breitscheid (unter dem Namen Phoenix-Glück auf!)[19][3][20] |  |
| Lahn-Dill-Kreis | Breitscheid | Engländer Grube, ab 1.11.1889 Gailsgruben[3] |
Grubenfeld auf Breitscheider Gemarkung, Vereinigung mit Trieschberg (gleiches Flöz)[21] | 18. Jh | Stollen[3] | |
| Lahn-Dill-Kreis | Breitscheid | Ludwig Haas I | zwischen Langenaubach[6] und Rabenscheid am Aubach 50° 41′ 18,9″ N, 8° 9′ 13,3″ O[22] |
1749–1768, ? - 1924/25 | Schacht; Ging hervor aus der Teilung des Feldes Ludwig Haas[3] |  |
| Lahn-Dill-Kreis | Breitscheid | Ludwig Haas II | zwischen Langenaubach[6] und Rabenscheid am Aubach 50° 41′ 35,9″ N, 8° 9′ 34,7″ O[22] |
1749–1768, ? - 1924/25 | Stollen; Ging hervor aus der Teilung des Feldes Ludwig Haas[3] |  |
| Lahn-Dill-Kreis | Breitscheid | Zeilers Zuversicht | südlich von Langenaubach, Richtung Medenbach[7] (50° 42′ 11,5″ N, 8° 11′ 1,5″ O)[22] |
nach 1832 | [3] | |
| Lahn-Dill-Kreis | Breitscheid | Kohlensegen | bei Gusternhain | um 1850 | [23] Soll als Geotop in den Geopark Westerwald-Lahn-Taunus eingebunden werden.[24] | |
| Lahn-Dill-Kreis | Breitscheid | Wohlfahrt | bei Gusternhain[25] | vor 1867[26] | nicht zu verwechseln mit der Tongrube Wohlfahrt bei Allendorf | |
| Lahn-Dill-Kreis | Haiger | Mariane[6] (Marianne[2]) |
bei Langenaubach | 1804–1945[27] | Stollen, später Schacht |  |
| Lahn-Dill-Kreis | Haiger | Trieschberg ab 1.11.1889 zu Gailsgruben[3] |
Stolleneingang bei Langenaubach in der Nähe des Steinbruchs Hohebühl (50° 41′ 51,9″ N, 8° 10′ 30,2″ O) auf ca. 493 m.ü.NN | 1837–1889 | Stollen; Grubenfeld auf Breitscheider Gemarkung[21] | |
| Lahn-Dill-Kreis | Driedorf | Heistern (In den Heistern) |
19.09.1845 | am 19.09.1845 verliehen; vergrößert am 21. März 1851; erweitert am 27.12.1869[26] | ||
| Lahn-Dill-Kreis | Greifenstein | Bierhain | 1866–1867 | [28]; Kohle schlechter Qualität, daher nur kurzzeitiger Abbau | ||
| Landkreis Limburg-Weilburg (Hessen) |
Waldbrunn | Gabe Gottes | bei Ellar | 1870-05-16- 1949 | gemutet am 16.5.1870; verliehen am 14.7.1870[29] | |
| Limburg-Weilburg | Waldbrunn | Lahr | bei Lahr | 1850–1949 | Stillstand 1917 – 1.12.1946; 150 Belegschaftsmitglieder[30] | |
| Daaden-Herdorf, Altenkirchen (Rheinland-Pfalz) |
Emmerzhausen | Adolfsburg (Adolphsburg) |
am Stegskopf (50° 42′ 14,6″ N, 8° 1′ 18,6″ O) |
1846–1872 (Stollen); verliehen am 23.3.1847 1903–1911 1921–1924, -1948; Förderung der Betriebsperiode um den Zweiten Weltkrieg herum von 5.488 t; Stollenlänge am 31.12.1947 von 400 m |
[31][16] | |
| Bad Marienberg, Westerwaldkreis (Rheinland-Pfalz) |
Dreisbach | ? | ||||
| Bad Marienberg | Lautzenbrücken | Kessel | 1867-05-27 | gemutet am 27.5.1867; verliehn am 1.8.1870[29] | ||
| Bad Marienberg | Kirburg | Glückauf | 50° 40′ 12,6″ N, 7° 55′ 38,2″ O? | |||
| Bad Marienberg | Norken | Spaeth | ?–1920er | Förderwagen an der Westerwaldstraße in Norken erhalten[13] | ||
| Bad Marienberg | Hof | Moritz | ||||
| Bad Marienberg | Hof | Sybille II | ||||
| Bad Marienberg | Bach (Nisterau) | Himburg | zwischen Bach und Rothenbach-Himburg | |||
| Bad Marienberg | Nisterau | Wilhelm (Wilhelmszeche) |
zwischen Bach und Fehl-Ritzhausen[17] (50° 39′ 20,1″ N, 7° 59′ 30,7″ O) |
1746?[32]–1926 | Stollen. Zeitweise mehr als 600 Beschäftigte. Besitzer um 1920 war der Berg- und Hüttenbetrieb Duisburg. Verladestation mit einem extra angelegten Bahnanschluss in Fehl-Ritzhausen. Ende der 1940er-Jahre von der Grube Alexandria wieder aufgeschlossen. | |
| Bad Marienberg | Bad Marienberg | Eintracht IV | am Bacher-Lay-Weg | ? – 1928 (Stollen) 1947–? (Tagebau) |
||
| Bad Marienberg | Bad Marienberg | Neue Hoffnung | unterhalb der Büchtingstraße | 1802[2]-1925 | Gelände später bekannt als „Bergehalde“ | |
| Bad Marienberg | Bad Marienberg | Neuhaus II | am Bacher-Lay-Weg | 1950–1951 | Tagebau mit Bagger, nur 3 Monate Betrieb | |
| Bad Marienberg | Bad Marienberg | Paul I. | bei Eichenstruth | |||
| Bad Marienberg | Bad Marienberg | In der Esch | bei Langenbach | 1718[33] | 1730[33] | |
| Bad Marienberg | Bad Marienberg | Unordnung[32] | bei Marienberg | um 1771 | ||
| Bad Marienberg | Bad Marienberg | Hohe Tanne[32] | bei Marienberg | um 1771 | ||
| Bad Marienberg | Bad Marienberg | Erle[32] | bei Marienberg | um 1771 | ||
| Bad Marienberg | Bad Marienberg | Birke[32] | bei Marienberg | um 1771 | ||
| Bad Marienberg | Bad Marienberg | Hainbuche[32] | bei Marienberg | um 1771 | ||
| Bad Marienberg | Hahn | Kaiser-Wilhelm-Stollen | Südlich der Straße Hahn-Höhn/Neu-Hochstein | zur Grube Victoria gehörig[34] | ||
| Bad Marienberg | Oberroßbach | Adolph (Adolfzeche) |
auf dem Niederfeld zwischen Fehl und Hof (50° 38′ 44,2″ N, 8° 0′ 44,1″ O) |
? – 1906 | ||
| Bad Marienberg | Stockhausen-Illfurth | Segen Gottes | zwischen Illfurth und Großseifen, „gegenüber“ der Grube Alexandria[23] (50° 38′ 6,1″ N, 7° 58′ 59″ O)[22] |
bis 1924 | ||
| Bad Marienberg | Stockhausen-Illfurth | Louisiana | zwischen Stockhausen und Eichenstruth, an „Oranien“ grenzend | um 1920 | ||
| Bad Marienberg | Stockhausen-Illfurth | Oranien | zwischen Stockhausen und Eichenstruth (50° 38′ 49″ N, 7° 58′ 4,1″ O)[22][35] |
1832 (mind.) – 1880 | ||
| Bad Marienberg | Unnau | Concordia | „Hintere Eichwiese“ (Gemarkung Unnau) auf der Marienberger Höhe zwischen Unnau, Bölsberg, Kirburg und Bad Marienberg (50° 39′ 18,3″ N, 7° 55′ 8,5″ O) |
1745 – nach 1923 | Stollen. Grube lieferte Kohle für den Eisenhammer bei Nister. Betreiber später vorübergehend „Gewerkschaft Neuhaus II“. Zahlreiche Halden im ehemaligen Grubengelände[36][37] | |
| Hachenburg, Westerwaldkreis (Rheinland-Pfalz) |
Gehlert | Eichnies | um 1875 | [38] | ||
| Hachenburg | Gehlert | Leopoldine | um 1875 | [38] | ||
| Hachenburg | Gehlert | Ludwigszeche II | um 1875 | [38] | ||
| Hachenburg | Gehlert | Redlichkeit I, II | 1875 | Mutungen[38] | ||
| Hachenburg | Nistertal-Büdingen | Stöffel | 1867-07-19 | gemutet am 19.7.1867; verliehen am 17.8.1870[29] | ||
| Selters, Westerwaldkreis (Rheinland-Pfalz) |
Kaden | Karl I | ||||
| Selters | Kaden | Friedrich III | ||||
| Wallmerod, Westerwaldkreis (Rheinland-Pfalz) |
Mähren | Mähren II | bei Mähren | 1867 | verliehen am 24. September 1867; erweitert am 7.4.1870 | |
| Westerburg, Westerwaldkreis (Rheinland-Pfalz) |
Bellingen | Humbold II | ||||
| Westerburg | Guckheim | Franziska | zwischen Guckheim und Sainscheid (50° 31′ 54,5″ N, 7° 57′ 12,8″ O) |
? - 1746, ? - ? | später Abbau von Tonerde, Flöze in der heutigen Tongrube sichtbar. „Berghaus“ am Guckheimer Ortseingang Richtung Sainscheid ist erhalten.[39][40] | |
| Westerburg | Hergenroth | Gnade Gottes | Abteilung der Grube Wilhelmsfund | |||
| Westerburg | Hergenroth | Wilhelmsfund | 1847 (vor) | ca. 60 Beschäftigte[41] | ||
| Westerburg | Höhn | Alexandria | 50° 37′ 35,5″ N, 7° 59′ 4,3″ O[22] | 1826-09-29 – 1961-04[12] | Schachtförderung; mind. 4 Schächte (Schacht „Christian“; Schacht "Anna"(92 m Teufe), Schacht IV); Tagesanlagen im Dezember 1989 niedergelegt; 1928 88.000 t gefördert[26] |  |
| Westerburg | Höhn | Anna (Schacht Anna) |
50° 37′ 26,9″ N, 7° 59′ 33,3″ O[22] | Schacht der Grube Alexandria | ||
| Westerburg | Höhn | Christian (Schacht Christian) |
Schacht der Grube Alexandria[26] | |||
| Westerburg | Höhn | Maria (Schacht Maria) |
zwischen Höhn und Ailertchen (50° 36′ 50,1″ N, 7° 58′ 21,6″ O)[22] |
|||
| Westerburg | Höhn | Nassau | bei Schönberg (50° 37′ 11,1″ N, 7° 58′ 14,8″ O)[22] |
ab 1780 | 1829 in Betrieb[9] Nassauischer Domänenbetrieb[42][35] | |
| Westerburg | Höhn | Siebert (Siebertsgrube) |
J. E. Siebert aus Hadamar war um 1865 Eigentümer der Gruben Alexandria und Eduard[25] | |||
| Westerburg | Höhn | Viktoria (Victoria) |
Stollen. Mundloch und Halden am Neu-Hochstein (Kackenberg) zwischen Höhn-Schönberg und Hahn[43] (50° 37′ 28,3″ N, 7° 57′ 7″ O, 50° 37′ 38″ N, 7° 57′ 3,6″ O)[22] | mehrere Einsturz- und Schacht-Pingen am Nordhang des Neu-Hochsteins[34] | ||
| Westerburg | Höhn | Waffenfeld | auf dem „Waffenfeld“ zwischen Hellenhahn-Schellenberg und Fehl-Ritzhausen[44] | um 1840–1860 | Nassauischer Domänenbetrieb[42] | |
| Westerburg | Langenhahn | Paul | Betreiber: Gewerkschaft Vulkan | |||
| Westerburg | Stahlhofen | Gerechtigkeit | am Weg von Oellingen nach Stahlhofen | 1907 war Besitzer Otto Nordhaus, beschäftigte über 100 Bergleute | ||
| Westerburg | Westerburg | Christiane | um 1850 | |||
| Westerburg | Westerburg | Einigkeit | ||||
| Westerburg | Westerburg | Franz I. | ||||
| Westerburg | Westerburg | Gute Hoffnung | bis 1925 | |||
| Westerburg | Kaden | Anna | heutiger Ortsteil „Grube Anna“, früher „Meiningen“ (50° 33′ 2,1″ N, 7° 54′ 35,5″ O) |
? – 1924 | Schachtanlage.[45] Betreiber: Gewerkschaft „Vulkan“.[46] Kohle wurde per Seilbahn nach Kölbingen gefahren, dort auf die Westerwald-Querbahn verladen. Verwaltungsgebäude ist erhalten. Teil eines Förderturmes und Förderwagen als Denkmal auf dem Dorfplatz von Kaden.[14] | |
| Westerburg | Kaden | Eduard (Eduardzeche) |
„Zechenhaus“ zwischen Kaden und Härtlingen (50° 32′ 38,1″ N, 7° 54′ 45,9″ O) |
1829 (vor) - ?, 1906 – ? | Gewerkschaft Dr. Schmieden & Marx aus Berlin, Drahtseilbahn zum Bahnhof Westerburg[1]. Schachtförderung; mind. 6 Schächte (Schacht I – IV)[26][47][35] | |
Literatur
- Otto Kleinschmidt: Industrien, Dienstleistungsbetriebe und Gewerkschaften im Oberwesterwald. Dritte, berichtigte und ergänzte Auflage. Selbstverlag, Koblenz Januar 2004 (Volltext gewchronik.mmk-online.eu [PDF]).
- Konrad Fuchs: Die Entwicklung des Braunkohlenbergbaus im Oberwesterwald. In: Verein für Nassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung (Hrsg.): Nassauische Annalen: Jahrbuch des Vereins für Nassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung. Bände 73-74. Verlag des Vereins für Nassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung, 1962, S. 183–203.
- Erbreich: Über das Braunkohlengebirge des Westerwaldes und die zu demselben in natürlicher Beziehung stehenden Felsarten. In: Archiv für Mineralogie, Geognosie, Bergbau und Hüttenkunde. Band 8. G. Reimer, Berlin 1835, S. 3–51.
- W. Casselmann: Chemische Untersuchungen über die Braunkohlen des Westerwaldes. In: Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde. Neuntes Heft, Abteilung II. Julius Niedner, Wiesbaden 1853, S. 49–81 (Volltext in der Google-Buchsuche).
- Karl Selbach: Geologische und bergmännische Beschreibung des Hohen und Oestlichen Westerwaldes. In: Das Berg- und Hüttenwesen im Herzogtum Nassau. Schlussheft. C. W. Kreidels, 1867, S. 1–108 (Volltext in der Google-Buchsuche – mit einer Liste der Braunkohlegruben auf Seiten 69–70).
- Hans-Joachim Häbel: Die Kulturlandschaft auf der Basalthochfläche des Westerwaldes vom 16. bis 19. Jahrhundert (= Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Nassau. Band 27). Historische Kommission für Nassau, 1980, ISBN 3-922244-34-3.
Weblinks
Einzelnachweise
-
Otto Kleinschmidt, 2004 (siehe Literatur)
mit fast identischem Inhalt alternativ auch als Website:
Otto Kleinschmidt: Chronik der Gewerkschaften im Oberwesterwald 1900–2000: Braunkohlenbergbau. 2004, abgerufen am 13. Mai 2013. - Jürgen Reusch: Jahreshauptversammlung 2010. (…) Der Braunkohlenbergbau im Hohen Westerwald. (Nicht mehr online verfügbar.) Gesellschaft für Heimatkunde im Westerwald – Verein, 19. April 2010, archiviert vom Original am 10. Januar 2014; abgerufen am 13. Mai 2013. Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
- Gerhard Lingenberg: Braunkohle in Alt-Breitscheid: Die Braunkohlengewinnung. Abgerufen am 13. Mai 2013.
- Ministerium für Umwelt Rheinland-Pfalz, Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht (Hrsg.): Planung Vernetzter Biotopsysteme. Bereich Landkreis Westerwald. Grafische Betriebe Staats GmbH, Februar 1993 (Volltext luwg.rlp.de).
- Thomas Schindler, Landesamt für Denkmalpflege Mainz: Lithostratigraphische Einheiten Deutschlands: Breitscheid-Formation. Lithographisches Lexikon, 17. März 2006, abgerufen am 23. Mai 2013.
- W. Casselmann, 1853 (siehe Literatur)
- C. F. Zincken: Die Physiographie der Braunkohle (= Die Braunkohle und ihre Verwendung. 1. Teil). Carl Rümpler, Hannover 1867 (Volltext in der Google-Buchsuche).
- Peter M. Schneider: Von Urpferden und Flugmäusen. Messel und Stöffel – Blick in die urzeitliche Ökosysteme. Scinexx, 14. Oktober 2005, abgerufen am 13. Mai 2013.
- Kirburg (= Karte vom Herzogthum Nassau. Blatt 8). 1819 (lagis-hessen.de).
- Jürgen Steup: Bei Steup's und ihren Vorfahren: Braunkohlenbergbau. (Nicht mehr online verfügbar.) Archiviert vom Original am 10. Januar 2014; abgerufen am 13. Mai 2013. Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
- Elektrizitätswerk Höhn. Gemeinde Höhn, abgerufen am 24. Mai 2013.
- Vor 50 Jahren kam das Aus für die Grube Alexandria. In: Westerwälder Zeitung. Regionalausgabe der Rhein-Zeitung. 9. März 2011 (Volltext im Onlinearchiv der RZ).
- Westerwaldstraße in Norken. Sendung vom 27. März 2012, 18:55 Uhr. SWR Fernsehen, Landesschau Rheinland-Pfalz, abgerufen am 24. Mai 2013.
- Manfred Schaaf: Westerwald-Querbahn, Teilstrecke Westerburg-Montabaur: Der ehemalige Bahnhof Kölbingen. 22. Juni 2008, archiviert vom Original am 10. Januar 2014; abgerufen am 24. Mai 2013.
- Gerd Bäumer: Erzbergbau im Raum Siegerland (Memento vom 7. November 2001 im Internet Archive)
- Der Bergwerks-Betrieb in dem preussischen Staate im Jahre 1852. In: Rudolf von Carnall, Preußisches Ministerium für Handel und Gewerbe (Hrsg.): Zeitschrift für das Berg-, Hütten und Salinenwesen im preussischen Staate. Band 1. W. Hertz, 1854, S. 63–118.
- Dillenburg (= Karte des Deutschen Reiches, 1:100 000. Blatt 459). 1911 (deutschefotothek.de).
- Uwe Peters, Verein Zeitsprünge e.V (Hrsg.): Museum Zeitsprünge mit Besucher- und Informationszentrum im Geopark Westerwald–Lahn–Taunus. Machbarkeitsstudie. Verein Zeitsprünge, Breitscheid 2010 (Volltext kulturhochdrei.eu [PDF]).
- Joachim B. Rolfes: Der Vergasungsversuch unter Tage von Breitscheid/Dillkreis, Springer, 144 Seiten
- Grube Glückauf-Phönix. Mineralienatlas, abgerufen am 24. Mai 2013.
- Gerhard Lingenberg: Braunkohle Trieschberghalde. Abgerufen am 24. Mai 2013.
-
Messtischblätter (Amtliche, topographische Karten 1:25000) der Preußischen Landesaufnahme (Uraufnahme, Neuaufnahme) und des Reichsamtes für Landesaufnahme (1870–1943) und des US-Army Map Service, verschiedene Jahre, online abrufbar aus dem System GeoGREIF, Teil der Greifswalder Digitalen Sammlungen der Universität Greifswald, aus dem Kartenforum der Deutschen Fotothek und aus der Harold B. Lee Library „G 6080 s25 ,G4“ an der Brigham Young University.
Blatt-Nummern des hier relevanten Bereiches:
Burbach (3041) Dillenburg (3042) Marienberg (3102) Rennerod (3103) Herborn (3104) Westerburg (3161) - Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde. Jahrgang XXXI und XXXII (1878 und 1879). Julius Niedner, Wiesbaden (Volltext archive.org).
- Karl Kessler: Den Stein ins Rollen gebracht. Wege zum Geopark Westerwald. (Nicht mehr online verfügbar.) Gesellschaft für Heimatkunde im Westerwald-Verein e.V., 7. November 2005, archiviert vom Original am 10. Januar 2014; abgerufen am 26. Mai 2013. Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
- Friedrich Carl Medicus: Bericht über die Nassauische Kunst- und Gewerbe-Ausstellung zu Wiesbaden im Juli und August 1863. Limbarth, 1865, S. 195–196 (eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).
- Karl Selbach: Geologische und bergmännische Beschreibung des Hohen und Oestlichen Westerwaldes. In: Das Berg- und Hüttenwesen im Herzogtum Nassau. Schlussheft. C. W. Kreidels, 1867, S. 1–108 (Volltext in der Google-Buchsuche – mit einer Liste der Braunkohlegruben auf Seiten 69–70).
- W. Casselmann: Chemische Untersuchungen über die Braunkohlen des Westerwaldes. In: Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde. Neuntes Heft, Abteilung II. Julius Niedner, Wiesbaden 1853, S. 49–81 (Volltext in der Google-Buchsuche).
- Wilhelm Riemann: Beschreibung des Bergreviers Wetzlar. Adolph Marcus, 1878, S. 115.
- Amtsblatt der preußischen Regierung in Wiesbaden, 1870
- Grube Lahr
- Marc Rosenkranz: Gruben in und um Emmerzhausen. Emmerzhausen 23. Oktober 2012 (emmerzhausen-westerwald.de [PDF]).
- Ernst Frohwein: Beschreibung des Bergreviers Dillenburg. Bonn 1885.
- Johann Philipp Becher: Mineralogische Beschreibung der Oranien-Nassauischen Lande: nebst einer Geschichte des Siegenschen Hütten- und Hammerwesens. 1789.
- Eberhard Klein: Hoher Westerwald. GEO-Touren, abgerufen am 11. Juni 2013.
- Das Berg- und Hüttenwesen im Herzogthum Nassau, herausgegeben von Odernheimer. Wiesbaden 1865
- Dr. Christian Stolz: Dreitägige Exkursion „Hoher Westerwald“. 29.-31. Mai 2007. Exkursionsführer. Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, Geographisches Institut, Mainz 2007 (rlb.de [PDF]).
- Landesforsten Rheinland-Pfalz – ZdF – Forsteinrichtung (Hrsg.): Wandertipp Forstamt Rennerod. Koblenz (wald-rlp.de [PDF]).
- Situationsriss von den Braunkohlenmutungen Redlichkeit I und II, Gemarkung Gehlert, Revier Dillenberg
- Alois Wolf: Bergbau in Sainscheid. Abgerufen am 11. Juni 2013.
- Braunkohlenbergbau im Oberwesterwald
- Fridolin Sandberger: Übersicht der geologischen Verhältnisse des Herzogthums Nassau, Verlag: Chr. W. Kreidel, Wiesbaden, 1847
- Otto Satorius: Nassauische Kunst- und Gewerbeausstellung in Wiesbaden 1863; Seite: 43; Wiesbaden 1863
- Karl Kessler, Eberhard Klein: Geotope im Westerwald. (Nicht mehr online verfügbar.) Gesellschaft für Heimatkunde im Westerwald – Verein, 2005, archiviert vom Original am 10. Januar 2014; abgerufen am 11. Juni 2013. Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
- Reh (= Karte vom Herzogthum Nassau. Blatt 6). 1819 (lagis-hessen.de).
- Godwin T. Petermann: Schachtanlage Anna von 1911 bei Caden (in Planung). Abgerufen am 11. Juni 2013.
- Kaden damals und heute: Bilder. Westerwälder Ortsgemeinde Kaden, abgerufen am 11. Juni 2013.
- Lageplan zum Stollenprojekt der Grube Eduard