Verband Deutscher Prädikatsweingüter
Der Verband Deutscher Prädikatsweingüter e. V. (VDP) ist eine Vereinigung von rund 200 Weingütern in Deutschland, der sich für verbindliche Qualitätsstandards und – seit 1990 – auch für die ökologische Bewirtschaftung der Weingüter seiner Mitglieder einsetzt.

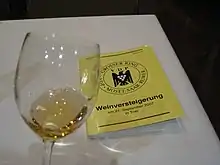
Geschichte
Der Verband wurde am 26. November 1910[1] als Verband Deutscher Naturweinversteigerer e. V.[2] gegründet. Gründungsmitglieder waren die vier Regionalvereine
- Verein der Naturwein-Versteigerer der Rheinpfalz, gegründet 1908
- Vereinigung Rheingauer Weingutsbesitzer, gegründet 1897 in Rüdesheim am Rhein
- Trierer Verein von Weingutsbesitzern von Mosel, Saar und Ruwer, gegründet vermutlich 1910
- Verein der Naturwein-Versteigerer in Rheinhessen, gegründet 1910.
Der Zusammenschluss erfolgte auf Betreiben von Winzern wie Ludwig Bassermann-Jordan und Friedrich von Bassermann-Jordan, sowie von Weinbaubeamten. Erster Vorsitzender war Albert von Bruchhausen, Oberbürgermeister der Stadt Trier.[1]
Der Ausdruck Naturwein sollte den besonderen Standard hervorheben, den unter dem damaligen Weingesetz die Weine hatten, die die damals gängige Praxis der Zuckerung zur Erhöhung des natürlichen Alkoholgehaltes bewusst nicht teilten. Die Eintragung ins Vereinsregister erfolgte allerdings erst 1926. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren deutsche Weine weltweit sehr gefragt und waren oftmals teurer als die immer noch berühmten Weine der z. B. großen Chateaux aus Bordeaux.
1934 wurde der Verein im Zuge der nationalsozialistischen Gleichschaltungspolitik in den „Reichsnährstand“ eingegliedert. 1935 wurde eine zweite Satzung beschlossen, die die Ziele des Verbandes erweiterte und konkretisierte:
- Regelung der Versteigerungsbedingungen und Termine
- gemeinsame Werbung
- Ausstellungen im In- und Ausland
- Austausch von Erfahrungen im Weinbau und in der Weinbehandlung
Der Zweite Weltkrieg unterbrach die Arbeit des Verbandes; der Weinvertrieb kam zum großen Teil zum Erliegen, da jüdische Weinhändler sehr wichtig für den Verkauf waren. Erst 1949 nahm er durch Albert Bürklin seine Arbeit formell wieder auf. 1955 fand die erste Spitzenweinversteigerung in Wiesbaden statt. Die Regeln wurden in den folgenden Jahren verschärft, allerdings brachte das Weingesetz von 1971 einen schweren Rückschlag für den Verein, der sich in Verband Deutscher Prädikatswein-Versteigerer e. V. (VDPV) umbenennen musste, um dem Weingesetz Rechnung zu tragen. Insbesondere die ausschließliche Definition von Weinqualität durch Oechslegrade und die Bereichs- bzw. Großlagen-Regelung sollten in der Folge Großproduzenten die Arbeit erleichtern und für den Kunden äußerlich erkennbare Qualitätsmerkmale verschwinden lassen.
Unter Peter von Weymarn änderte der Verband seinen Namen in die aktuelle Bezeichnung. Ferner wandelte er sich in einen Zusammenschluss von Weingütern. Die Organisation von Weinversteigerungen rückte in den Hintergrund. Eine veränderte Satzung richtete 1972 den in Verband Deutscher Prädikatsweingüter umbenannten Verein auf Imagepflege und Förderung des Qualitätsstrebens aus. 1978 übernahm Erwein Graf Matuschka-Greiffenclau den Vorsitz, 1982 erfolgte die Umbenennung in Verband Deutscher Prädikats- und Qualitätsweingüter.
Ab 1990, unter Michael Prinz zu Salm-Salm, wurde der Verband und damit seine Mitglieder auf naturnahen Weinbau eingeschworen und zu einer Umstellung der Betriebspraxis aufgefordert. Seit 1994 werden keine Großlagen-Bezeichnungen mehr verwendet und ab dem Prädikat Auslese ist Handlese obligatorisch. 2002 verabschiedete die Mitgliederversammlung das Statut zur Klassifikation von Ersten Gewächsen und Großen Gewächsen.
Der Präsident des Verbandes ist seit 2007 Steffen Christmann. Im Mai 2012 zog die Bundesgeschäftsstelle des Verbandes in das denkmalgeschützte Weinlagergebäude des ehemaligen Zoll- und Binnenhafens der Stadt Mainz um.
Seit 1. Januar 2020 ist mit dem Sekthaus Raumland das erste reine Sekthaus Mitglied im VDP.
Klassifikation
Im Jahr 2012 verabschiedeten die Mitglieder einstimmig eine neue Klassifikation, die die Qualität nach der Herkunft definieren soll. Sie ersetzt die Klassifikation nach dem Weingesetz von 1971, welche die Qualität nach dem Mostgewicht (Grad Oechsle) maß. Ziel ist es, dass nur die herausragenden Lagen auf dem Etikett benannt werden. Bereits das Weingesetz von 1971 kürzte die Liste der Lagen von zuvor ca. 30 000 Lagen in 4 000 Groß- und Einzellagen.
Die neue Klassifikation hat die vier Stufen (in aufsteigender Qualität):
- VDP.Gutswein
- VDP.Ortswein
- VDP.Erste Lage
- VDP.Große Lage
In manchen Regionen wird die Bezeichnung VDP.Erste Lage nicht verwendet. Der beste trockene Wein aus einer VDP.Große Lage heißt VDP.Großes Gewächs.[3]
Die Klassifikation lässt zusätzlich den Gebrauch von Prädikatsnamen nur für die frucht- und edelsüßen Weine zu: Kabinett, Spätlese, Auslese, Beerenauslese, Trockenbeerenauslese und Eiswein.
Sie wurden bereits vor 1971 verwendet, durch das Weingesetz aber entfernt.
Über die Möglichkeit, die alten Katasternamen und zusätzlich geschützte Ursprungsbezeichnungen einzutragen, wird Winzern ermöglicht, ihre Lagen weiter aufzusplitten und so besondere Lagen als VDP.Große Lage zu bezeichnen.[4]
Im Juli 2018 verabschiedeten die Mitglieder eine Sektklassifikation, die wie die Weinklassifikation die Qualität nach der Herkunft definiert und als zusätzliches Qualitätskriterium die Lagerung auf der Hefe vorsieht. Im Zentrum steht demnach die Herkunft mit den qualitativ steigenden Stufen VDP-Gutssekt, VDP-Ortssekt, VDP-Erste Lage und VDP-Große Lage. Die Technologie der Flaschengärung ist obligatorisch. Guts- und Ortssekte müssen mindestens 15 Monate auf der Hefe liegen, Lagensekte und alle Jahrgangssekte mindestens 36 Monate.[5]
Präsidenten des Verbandes
- 1910–1934: Albert von Bruchhausen
- 1934–1949: Jakob Werner
- 1949–1969: Albert Bürklin
- 1969–1972: Wolfgang Michel
- 1972–1978: Peter W. von Weymarn
- 1978–1990: Erwein Graf Matuschka-Greiffenclau
- 1990–2007: Michael Prinz zu Salm-Salm
- seit 2007: Steffen Christmann
Weingüter
Folgende rund 200 Weingüter sind Mitglieder (Stand Januar 2021):
|
Ahr:
|
Franken:
|
|
|
Mosel (vormals Mosel-Saar-Ruwer):
Nahe:
|
|
|
|
|
Traubenadler

Der Traubenadler ist das Verbandssymbol.[6] Es zeigt einen symbolhaft dargestellten Adler mit einer Weintraube im Schnabel. Seit 2003 wird er auch als Gütesiegel auf der Flaschenkapsel dargestellt. Er kennzeichnet Weine von Verbandsmitgliedern und soll als Gütesiegel eine terroirgeprägte, handwerkliche Weinbereitung signalisieren, die Eichenholzchips ausschließt und die Verwendung von Zusatzstoffen beschränkt. Weine aus dem Versuchsanbau des Verbandes erhalten das Siegel nicht.[7][8] Die Darstellung auf der Kapsel ist ein Piktogramm, das die Silhouette eines Adlers mit Weinbeeren im Brustbereich zeigt.
VDP-Trophy „Herkunft Deutschland“
Die Prädikatsweingüter verleihen die VDP-Trophy „Herkunft Deutschland“ seit 2001 an herausragende Publizisten, die sich durch ihre Arbeit um den deutschen Wein verdient gemacht und dazu beigetragen haben, den deutschen Wein weltweit wieder salonfähig zu machen. Bisher wurde der Preis verliehen an:
- 2001 sechs Journalisten der Frankfurter Allgemeinen Zeitung für ihrer Serie „Bericht zur Lage“: Georg Küffner, Oliver Bock, Daniel Deckers, Horst Dohm, Alfred Behr, Roswin Finkenzeller
- 2002 die Zeitschriften Der Feinschmecker und Weingourmet
- 2003 den Weinführer Gault Millau Wein-Guide Deutschland und das Magazin Alles über Wein mit den Autoren Armin Diel und Joel Payne
- 2004 das Weinmagazin Vinum und dessen damaliger Redakteur Rudolf Knoll
- 2005 den britischen Weinkritiker Stuart Pigott
- 2006 den Hamburger Weinautor Mario Scheuermann
- 2009 den britischen Autor Freddy Price
- 2012 den Autor Gerhard Eichelmann
- 2015 den Weinkritiker Marcus Hofschuster
Siehe auch
Literatur
- Daniel Deckers: Im Zeichen des Traubenadlers: Eine Geschichte des deutschen Weins. Verlag Philipp von Zabern, Mainz 2010, ISBN 978-3-8053-4248-3.
- Theodor Böttiger: Die Weine Deutschlands. München 1974. ISBN 3-453-40152-2.
Weblinks
Einzelnachweise
- VDP.Die Prädikatsweingüter: Die Geschichte des Bundesverbands. Abgerufen am 27. November 2016.
- Naturweine sind die Prädikatsweine von heute.
- VDP-Klassifikationsmodell (Memento vom 25. August 2014 im Internet Archive), abgerufen am 20. Dezember 2014.
- Warum eine Klassifikation. VDP, abgerufen am 24. Oktober 2014.
- VDP-Sekt-Statut, abgerufen am 17. Juli 2018.
- Mitgliederversammlung der Prädikatsweingüter beschließt klare Positionierung. In: germanwine.de. 30. Juli 2006, abgerufen am 8. Januar 2021.
- Mitgliederversammlung der Prädikatsweingüter beschließt klare Positionierung. Der VDP-Traubenadler auf jeder Flaschenkapsel signalisiert eine terroirgeprägte, handwerkliche Weinbereitung. In: germanwine.de. 2006, abgerufen am 22. Oktober 2013.
- Was bedeuten 1 und "Traubenadler" des VDP? In: Die Welt. 11. Oktober 2009, abgerufen am 22. Oktober 2013.