Volkskammer
Die Volkskammer war vom 7. Oktober 1949 bis zum 2. Oktober 1990[1] das Parlament und nominell höchste Verfassungsorgan der Deutschen Demokratischen Republik (DDR).



Entstehung und Funktion

.jpg.webp)

Die Provisorische Volkskammer wurde am 7. Oktober 1949 in Ost-Berlin aus dem Zweiten Deutschen Volksrat gebildet. Die erste Volkskammerwahl erfolgte, verspätet und nach einem anderen Wahlsystem als ursprünglich geplant, am 15. Oktober 1950. Die Wahlen ab 1950 (siehe Volkskammerwahl 1950) beruhten auf Einheitslisten der Nationalen Front. Da das Ergebnis vorher feststand, falteten viele DDR-Bürger den Stimmzettel und warfen ihn ungelesen in die Wahlurne. Dieser Vorgang wurde im Volksmund „falten gehen“ genannt.[2] Die einzigen freien Wahlen waren die Volkskammerwahl 1990 und die danach noch stattfindenden Kommunalwahlen. Die Wahlen fanden zuvor vielerorts nicht mehr geheim statt:[3] Wahlkabinen waren zwar vorhanden, ihre Benutzung wurde aber als Zeichen für Opposition zum System gewertet. Nach offiziellen Angaben habe die Wahlbeteiligung 98 % betragen und 99,7 % für die Nationale Front gestimmt.[3] Aus Akten des Ministeriums für Staatssicherheit konnte nach dem Ende der DDR belegt werden, dass umfangreiche Wahlfälschungen vorgenommen worden waren.[3] Wahlmanipulationen waren auch bei späteren Wahlen zur Volkskammer die Regel. Die Abgeordneten waren in ihrem Abstimmungsverhalten an die politischen Vorgaben der SED gebunden. Bis 1958 bestand neben der Volkskammer eine Länderkammer, die von ihrem Recht, Gesetzentwürfe in die Volkskammer einbringen und aufschiebenden Widerspruch gegen Gesetzesbeschlüsse zu erheben, nie Gebrauch machte.
Die Volkskammer wählte 1949 Wilhelm Pieck (1876–1960) zum Präsidenten der DDR. Nach dessen Tod 1960 wurde die Funktion des Präsidenten durch den Staatsrat der DDR beziehungsweise dessen Vorsitzenden ersetzt, die von der Volkskammer gewählt wurden.
Nach dem Verständnis der sowjetischen Besatzungsmacht und der SED war die Volkskammer kein Parlament im bürgerlichen Sinne einer repräsentativen Demokratie, sondern sollte eine Volksvertretung neuen Typs darstellen. Sie sollte den postulierten Ansprüchen nach die im bürgerlichen Parlamentarismus nicht gegebene Einheit zwischen politischer Führung und Bevölkerung herstellen und Parteienegoismus, Parteinahme für das Kapital, persönliche Bereicherungssucht und Selbstblockade durch Gewaltenteilung ausschließen.[4]
Die einzige Abstimmung der Volkskammer, in der Konflikte öffentlich bekannt wurden, war im März 1972 die Abstimmung über das Gesetz über die Unterbrechung der Schwangerschaft zur Einführung der Fristenlösung bei Schwangerschaftsabbrüchen, bei der 14 Abgeordnete der CDU nach Absprache mit ihrer Parteiführung gegen das Gesetz stimmten. Diese Gegenstimmen und einige Enthaltungen blieben jedoch ohne Wirkung auf den Gesetzgebungsprozess zur Fristenlösung, erhöhten auf der anderen Seite aber die Legitimation der Volkskammer, da in diesem Fall in der Öffentlichkeit der Eindruck eines echten, streitenden Gremiums entstand.[5][6]
Faktisch war die Volkskammer weitgehend ohne Einfluss auf das politische Geschehen, denn der seit 1968 in der Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik auch offiziell verankerte Führungsanspruch der SED verhinderte von Beginn an eine echte politische Einflussnahme des Parlaments.
Arbeitsweise und Zusammensetzung

Die Volkskammer tagte üblicherweise zwei- bis viermal im Jahr, die Sitzungen waren nach § 6 der Geschäftsordnung grundsätzlich öffentlich. Sie tagte zwischen 1950 und 1970 im Langenbeck-Virchow-Haus. Danach diente die Kongresshalle am Alexanderplatz als Tagungsort. Ab 1976 fanden ihre Sitzungen im kleinen Saal des neu gebauten Palastes der Republik statt. Nach der Schließung des Palastes der Republik im September 1990 tagte die Volkskammer zuletzt im Haus am Werderschen Markt.
Die Volkskammer verfügte über die folgenden Ausschüsse:
- Ausschuss für Allgemeine Angelegenheiten (1950–1963)
- Ausschuss für Örtliche Volksvertretungen (1956–1963)
- Ausschuss für Wirtschafts- und Finanzfragen (1950–1963)
- Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten (1950–1990)
- Ausschuss für Arbeit und Gesundheitswesen (1950–1958)
- Ausschuss für Gesundheitswesen (1958–1990)
- Ausschuss für Arbeit und Sozialpolitik (1958–1990)
- Ausschuss für Handel und Versorgung (1963–1990)
- Petitionsausschuss bzw. Ausschuss für die Eingaben der Bürger (1950–1990)
- Geschäftsordnungsausschuss (1950–1990)
- Gnadenausschuss (1950–1963), Aufgabe danach vom Staatsrat der DDR übernommen
- Haushalts- und Finanzausschuss (1950–1990)
- Mandatsprüfungsausschuss (1963–1990)
- Jugendausschuss (1950–1990)
- Justizausschuss (1950–1963)
- Ausschuss für Nationale Verteidigung (1963–1990)
- Ausschuss für Industrie, Bauwesen und Verkehr (bis 1990)
- Ausschuss für Land- und Forstwirtschaft (1950–1990)
- Ausschuss für Volksbildung und Kultur (1954–1958)
- Ausschuss für Kultur (1958–1990)
- Ausschuss für Volksbildung (1958–1990)
- Rechtsausschuss (1950–1963)
- Wahlprüfungsausschuss (1950–1963)
- Verfassungsausschuss bzw. Verfassungs- und Rechtsausschuss (1950–1990)
Die Volkskammer hatte bis 1963 400 Sitze, danach 500. Bis zur 5. Wahlperiode (1967–1971) gehörten 66 Berliner Vertreter der Volkskammer mit beratender Stimme an, danach waren diese normale Abgeordnete. Seit Ende 1958 nahmen an den Sitzungen und an der Ausschussarbeit 100, später 200 Nachfolgekandidaten teil. Diese hatten kein Stimmrecht in den Abstimmungen, waren den regulären Abgeordneten aber sonst weitgehend gleichgestellt.
Folgende Fraktionen waren von 1950 bis April 1990 in der Volkskammer vertreten: SED-Fraktion, CDU-Fraktion, LDPD-Fraktion, NDPD-Fraktion, DBD-Fraktion, FDGB-Fraktion, FDJ-Fraktion, DFD-Fraktion, Kulturbund-Fraktion, VdgB/Konsumgenossenschaften-Fraktion (nur von 1950 bis 1963 und ab 1986) sowie VVN-Fraktion (1950–1954).
| Name der Fraktion |
Kürzel der Fraktion |
Anzahl der Abgeordneten |
Pseudografische Darstellung der Anzahl der Abgeordneten |
|---|---|---|---|
| Sozialistische Einheitspartei Deutschlands | SED | 127 | •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• |
| Christlich-Demokratische Union | CDU | 52 | •••••••••••••••••••••••••• |
| Liberal-Demokratische Partei Deutschlands | LDPD | 52 | •••••••••••••••••••••••••• |
| Demokratische Bauernpartei Deutschlands | DBD | 52 | •••••••••••••••••••••••••• |
| National-Demokratische Partei Deutschlands | NDPD | 52 | •••••••••••••••••••••••••• |
| Freier Deutscher Gewerkschaftsbund | FDGB | 68 | •••••••••••••••••••••••••••••••••• |
| Freie Deutsche Jugend | FDJ | 40 | •••••••••••••••••••• |
| Demokratischer Frauenbund Deutschlands | DFD | 35 | •••••••••••••••••• |
| Kulturbund | KB | 22 | ••••••••••• |
Der Anteil von Frauen an den Abgeordneten betrug 1950 23,0 Prozent (mit Berliner Vertretern), 1986 32,2 Prozent. Die Mehrheit der SED in der Volkskammer seit 1950 wurde durch die Fraktionen der Massenorganisationen (FDGB, DFD, FDJ, KB) gesichert, deren Fraktionsmitglieder in der Regel zugleich Mitglieder der SED waren.
Prominente Abgeordnete waren neben allen wichtigen SED-Parteifunktionären und Vorsitzenden der anderen Parteien unter anderem prominente Leistungssportler wie Heike Drechsler oder Täve Schur und Arbeiteraktivisten sowie Veteranen der sozialistischen Bewegung bzw. des DDR-Aufbaus wie Rosa Thälmann, Kurt Krjeńc, Käthe Kern und Wilhelmine Schirmer-Pröscher.
Wahltermine und amtliche Ergebnisse

Die Ergebnisse der Volkskammerwahlen (teils auch Volkswahlen) von 1950 bis 1986 gelten als nicht demokratisch zustande gekommen.
| Wahltermin | Wahlbeteiligung | Ja-Stimmen | ungültig |
|---|---|---|---|
| 1. Wahlperiode: 15. Oktober 1950 | 98,53 | 99,72 | 0,28 |
| 2. Wahlperiode: 17. Oktober 1954 | 98,51 | 99,46 | 0,54 |
| 3. Wahlperiode: 16. November 1958 | 98,90 | 99,87 | 0,13 |
| 4. Wahlperiode: 20. Oktober 1963 | 99,25 | 99,95 | 0,05 |
| 5. Wahlperiode: 2. Juli 1967 | 99,82 | 99,93 | 0,07 |
| 6. Wahlperiode: 14. November 1971 | 98,48 | 99,85 | 0,15 |
| 7. Wahlperiode: 17. Oktober 1976 | 98,58 | 99,86 | 0,14 |
| 8. Wahlperiode: 14. Juni 1981 | 99,21 | 99,86 | 0,14 |
| 9. Wahlperiode: 8. Juni 1986 | 99,74 | 99,94 | 0,06 |
| 10. Wahlperiode: 18. März 1990 | 93,40 | Wahlergebnis | 0,55 |
Präsidenten der Volkskammer
| Nr. | Name | Beginn der Amtszeit | Ende der Amtszeit | Partei |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Dieckmann | 7. Oktober 1949 | 22. Februar 1969 | LDPD |
| 2 | Gerald Götting | 12. Mai 1969 | 29. Oktober 1976 | CDU |
| 3 | Horst Sindermann | 29. Oktober 1976 | 13. November 1989 | SED |
| 4 | Günther Maleuda | 13. November 1989 | 5. April 1990 | DBD |
| 5 | Sabine Bergmann-Pohl | 5. April 1990 | 2. Oktober 1990 | CDU |
Die frei gewählte Volkskammer 1990
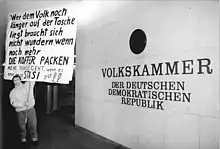
Nach der 1989 durch Bürgerproteste ausgelösten politischen Wende und friedlichen Revolution in der DDR wurde am 18. März 1990 die einzige freie Volkskammerwahl abgehalten. Die Macht des Parlaments entsprach nun erstmals jener der Parlamente bürgerlicher Demokratien. Die Volkskammer schuf mit dem Ländereinführungsgesetz die neuen Bundesländer, die mit ihrer Gründung Teil der Bundesrepublik wurden. Die DDR war damit abgeschafft. Gleichzeitig veranlasste die Volkskammer eine „Mindest-Gesetzesausstattung“ für die neuen Länder, die damit sofort mit ihrer Gründung über Landesrecht verfügten. Zwar war der Einigungsvertrag, der u. a. regelte, welche Bundesgesetze im Beitrittsgebiet nicht oder nur modifiziert gelten sollten, durch die Regierungen ausgehandelt worden, doch hatten die Regierungsfraktionen im Vorfeld eine Fülle von Bedingungen formuliert (etwa: Bestand der Bodenreform), die in den Vertrag einflossen.
Bei der konstituierenden Sitzung am 5. April wurde durch die Einfügung des Artikels 75a in die Verfassung der DDR das Präsidium der Volkskammer mit den Befugnissen des nicht mehr besetzten Staatsrates betraut. Die am selben Tag gewählte Präsidentin der Volkskammer, Sabine Bergmann-Pohl (CDU), erhielt die Befugnisse des Staatsratsvorsitzenden und war damit formell letztes Staatsoberhaupt der DDR.
Am 12. April 1990 wurde Lothar de Maizière (CDU) mit 265 Stimmen bei 108 Gegenstimmen und 9 Enthaltungen zum Ministerpräsidenten der DDR gewählt. Die Abgeordneten bestätigten danach en bloc auch das Kabinett de Maizières, die erste und letzte frei gewählte Regierung der DDR.
In ihrer historischen Sitzung vom 23. August 1990 beschloss die Volkskammer den Beitritt der DDR zur Bundesrepublik Deutschland mit Wirkung zum 3. Oktober 1990 und damit das Ende der DDR als Völkerrechtssubjekt.[7]
CDU/DA-Fraktion
Die Fraktion nannte sich offiziell „CDU/DA“ bis zum 5. August 1990, also dem Tag der Fusion der beiden Organisationen. Danach nannte sie sich „CDU-Fraktion“. Die Vorsitzenden waren:
- 27. März–10. April: Lothar de Maizière
- 10. April–2. Oktober: Günther Krause
SPD-Fraktion
Die Vorsitzenden der Fraktion der SPD waren:
- 21. März–26. März: Ibrahim Böhme
- 26. März–21. August: Richard Schröder
- ab 21. August: Wolfgang Thierse
PDS-Fraktion
Der Vorsitzende der PDS-Fraktion war während der ganzen Legislaturperiode Gregor Gysi.
DSU-Fraktion
Die Fraktion der DSU hatte von März bis Oktober nur einen Vorsitzenden, Hansjoachim Walther.
Fraktion „Die Liberalen“
Die Fraktion „Die Liberalen“ war eine Fraktionsgemeinschaft von FDP, DFP, LDP und NDPD. Bei der Volkskammerwahl nahmen die ersten drei Parteien als Mitglieder der Listenverbindung Bund Freier Demokraten teil, die NDPD stellte eine eigene Liste. Nach der Bildung der Volkskammer schlossen sich die zwei Abgeordneten der NDPD der liberalen Fraktion an. Der Vorsitzende der Fraktion war bis Oktober Rainer Ortleb.
Fraktion Bündnis 90/Grüne
Bündnis 90 bildete eine Fraktionsgemeinschaft mit den Grünen, die keinen Fraktionsvorsitzenden, sondern mehrere Fraktionssprecher hatte. Die Sprecher der Fraktion waren:
- Jens Reich (zeitweise vertreten durch Werner Schulz, beide Bündnis 90) während der ganzen Periode;
- Vera Wollenberger von den Grünen auch durchgehend;
- Wolfgang Ullmann wurde im April zum Vizepräsidenten der Volkskammer gewählt, an seine Stelle trat Marianne Birthler (beide Bündnis 90).
DBD/DFD-Fraktion
Die Demokratische Bauernpartei Deutschlands und die einzige Abgeordnete des Demokratischen Frauenbunds Deutschlands bildeten in der Volkskammer eine Fraktionsgemeinschaft, deren Vorsitzender Günther Maleuda war. Am 29. August 1990 beschloss die Fraktion ihre Auflösung. Maleuda blieb fraktionslos, drei DBD-Abgeordnete schlossen sich der SPD, vier der CDU an, ein DBD-Abgeordneter und die Abgeordnete des DFD wechselten zur Fraktion der Liberalen.
Fraktionslos
Der über das Aktionsbündnis Vereinigte Linke gewählte Abgeordnete Thomas Klein blieb fraktionslos.
Siehe auch
Literatur
- Bettina Tüffers: Die 10. Volkskammer der DDR. Ein Parlament im Umbruch. Selbstwahrnehmung, Selbstparlamentarisierung, Selbstauflösung, Düsseldorf 2016, ISBN 978-3-7700-5333-9.
- Nicole Glocke: Spontaneität war das Gebot der Stunde. Drei Abgeordnete der ersten und einzigen frei gewählten DDR-Volkskammer berichten. Mitteldeutscher Verlag, Halle (Saale) 2012, ISBN 978-3-89812-898-8.
- Christopher Hausmann: Biographisches Handbuch der 10. Volkskammer der DDR (1990). Böhlau Verlag, Köln/Weimar/Wien 2000, ISBN 3-412-02597-6.
- Werner J. Patzelt, Roland Schirmer (Hrsg.): Die Volkskammer der DDR. Sozialistischer Parlamentarismus in Theorie und Praxis. Westdeutscher Verlag, Wiesbaden 2002, ISBN 3-531-13609-7.
- Peter Joachim Lapp: Die Volkskammer der DDR. Studien zur Sozialwissenschaft. Bd. 33. Westdeutscher Verlag, Opladen 1975, ISBN 3-531-11299-6.
- Gabriele Gast: Die politische Rolle der Frau in der DDR. Studien zur Sozialwissenschaft. Bd. 17. Bertelsmann Universitätsverlag, Düsseldorf 1973, ISBN 3-571-09219-8.
- Handbücher der Volkskammer der DDR 1957 bis 1986. Staatsverlag der DDR, Berlin.
Weblinks
Einzelnachweise
- Letzte Tagung der Volkskammer und Bilanz, 2. Oktober 1990 (Memento vom 16. Oktober 2011 im Internet Archive) (abgerufen am 20. August 2011).
- Birgit Wolf: Sprache in der DDR. Ein Wörterbuch. Walter de Gruyter, Berlin/New York 2000, ISBN 978-3-11-080592-5, S. 59 f. (abgerufen über De Gruyter Online).
- Hermann Weber: Die DDR 1945–1990. 4. Auflage, Oldenbourg, 2006, S. 32.
- Vgl. Klaus Sorgenicht, Wolfgang Weichler, Tord Riemann, Hans-Joachim Semler (Hrsg.): Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik. Dokumente, Kommentare, Bd. 1, Staatsverlag der DDR, Berlin (Ost) 1969; Kommentar zu Art. 5 der DDR-Verfassung von 1968, S. 277–278: „In ihrer Zusammensetzung und ihrer gesamten Tätigkeit sind die Volksvertretungen nicht als Parlamente konzipiert und zu betrachten, sondern als Verkörperung des Bündnisses, des gemeinsamen Wollens und der Zusammenarbeit aller politischen Kräfte des Volkes.“
- Ehrhart Neubert: Geschichte der Opposition in der DDR 1949–1989. 2., durchges. und erw. Aufl., Ch. Links Verlag, Berlin 1998, ISBN 3-86153-163-1, S. 204.
- Udo Wengst, Hermann Wentker: Das doppelte Deutschland. Ch. Links Verlag, 2008, ISBN 978-3-86153-481-5, S. 185–187.
- Beschluss der Volkskammer über den Beitritt der DDR zum Geltungsbereich des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland vom 23. August 1990 (Memento vom 26. August 2010 im Internet Archive)