Ministerium für Chemische Industrie
Das Ministerium für Chemische Industrie der DDR (MfC) bestand von 1965 bis 1989. Es war das zentrale Anleitungs- und Kontrollorgan zur Planung und Leitung der gesamten chemischen Industrie in der DDR.

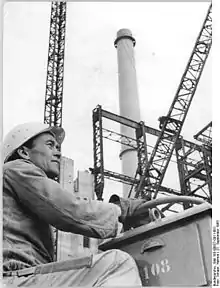
Geschichte
Vorgänger des Ministeriums für Chemische Industrie war das Staatssekretariat für Chemie, Steine und Erden, das im November 1951 durch Aufgliederung des Ministeriums für Schwerindustrie entstand und im April 1953 in das Staatssekretariats für Chemie umbenannt wurde. Im November 1953 wurde das Staatssekretariat erneut in das Ministerium für Schwerindustrie eingegliedert.
Nachdem am 1. Januar 1954 die SAG-Betriebe – darunter unter anderem auch die der chemischen Industrie – von der Sowjetunion an die DDR zurückgegeben worden waren, wurde 1955 das Ministerium für Schwerindustrie in das Ministerium für Erzbergbau, Metallurgie und Kali, das Ministerium für Kohle und Energie sowie das Ministerium für Chemische Industrie aufgeteilt. Diese Ministerien wurden jedoch später in den Volkswirtschaftsrat der DDR eingegliedert.
Nach Auflösung des Volkswirtschaftsrates Ende 1965 wurde das MfC erneut gebildet. Es bestand bis zum Rücktritt des von Willi Stoph geleiteten Ministerrats am 7. November 1989. Anschließend wurden dessen Aufgaben wieder von einem Ministerium für Schwerindustrie wahrgenommen. Die chemische Industrie der DDR nahm Ende der 1980er Jahre mit rund 18 % der industriellen Bruttoproduktion den zweiten Platz hinter dem Industriebereich Maschinen- und Fahrzeugbau ein.
Vor allem der mitteldeutsche Raum mit dem sogenannten Chemiedreieck Wolfen – Leuna – Bitterfeld war ein bedeutender Produktionsstandort für die chemische Grundstoffindustrie der DDR. Das größte Chemiewerk Europas, die aus den ehemaligen I.G.-Farben-Werken in Bitterfeld hervorgegangene Leunawerke und andere dort angesiedelte Chemiebetriebe wurden nach dem 1958 vom ZK der SED beschlossenen Chemieprogramm ausgebaut.
Die Städte des Mitteldeutschen Chemiedreieckes entwickelten sich dabei nicht nur zu wichtigen industriellen Zentren in der DDR, sondern wurden auch Keimzellen und entscheidende Ausgangspunkte einer neuen „sozialistischen Kulturpolitik“. Hier wurden der Bitterfelder Weg, die Zirkel schreibender Arbeiter, die Arbeiterfestspiele der DDR und die Brigaden der sozialistischen Arbeit ins Leben gerufen.
Entwicklungsschwerpunkte der chemischen Industrie waren die Mineralölverarbeitung sowie die Herstellung von Kunststoffen, synthetischen Fasern sowie Düngemitteln. Die bedeutende Kali- und Steinsalzindustrie unterstand jedoch dem Ministerium für Erzbergbau, Metallurgie und Kali.
Mit der Umstellung des Rohstoffeinsatzes von Braunkohle auf Erdöl erfolgte in den 60er Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts ein tiefgreifender Strukturwandel in der chemischen Industrie der DDR. Grundlage für diesen Strukturwandel war die ab 1959 errichtete Erdölleitung Freundschaft von den sowjetischen Erdölfeldern nach Schwedt, Leuna und Böhlen.

In den 1970er Jahren wurden in der DDR erhebliche Summen in neue Chemieanlagen bzw. in den Kapazitätsausbau investiert, so dass die Erdölverarbeitung im Jahre 1980 auf 22 Millionen Tonnen anstieg. Als die Sowjetunion ab 1982 die Erdöllieferungen, für die Preise unter Weltmarktniveau gezahlt wurden, deutlich verringerte, traf diese Reduktion die Chemieindustrie und die gesamte DDR-Wirtschaft hart.
Unterstellte Kombinate
Dem MfC unterstanden folgende 16 zentralgeleitete Kombinate:
- VEB Chemieanlagenbaukombinat, Leipzig-Grimma
- VEB Chemiefaserkombinat „Wilhelm Pieck“, Schwarza
- VEB Chemiekombinat Bitterfeld
- VEB Chemische Werke Buna, Schkopau
- VEB Fotochemisches Kombinat, Wolfen
- VEB Leuna-Werke „Walter Ulbricht“, Leuna
- VEB Kombinat Agrochemie, Piesteritz
- VEB Kombinat Lacke und Farben, Berlin
- VEB Kombinat Minol, Berlin
- VEB Kombinat Plast- und Elastverarbeitung, Berlin
- VEB Kombinat Synthesewerk „Walter Ulbricht“, Schwarzheide
- VEB Kosmetik-Kombinat, Berlin
- VEB Pharmazeutisches Kombinat GERMED, Dresden
- VEB Petrolchemisches Kombinat, Schwedt/Oder
- VEB Reifenkombinat, Fürstenwalde
- VEB Kombinat Zellstoff und Papier, Heidenau.
Minister
- Werner Winkler (SED, 1956–1958)
- Siegbert Löschau (SED, 1965–1966)
- Günther Wyschofsky (SED, 1966–1989)
Staatssekretäre
| Zeitraum | Name | Partei |
|---|---|---|
| 1951–1953 | Dirk van Rickelen | SED |
| 1953–1956 | Werner Winkler | SED |
| 1956–1958 | Hans Adler | SED |
| 1965–1969 | Karl-Heinz Schäfer | SED |
| 1969–1975 | Karl Kaiser | SED |
| 1975–1989 | Guido Quaas | SED |
| 1977–1983 | Hans-Joachim Kozyk | SED |
| 1985–1989 | Siegfried Hanne | SED |
Literatur
- Ursula Hoffmann: Die Veränderungen in der Sozialstruktur des Ministerrates der DDR 1949–1969. Droste, Düsseldorf 1971, S. 104.
- Bundesministerium des Innern (Hrsg.): DDR-Handbuch. 3. und erw. Aufl. Verlag Wissenschaft und Politik, Köln 1984, S. 901.
- Andreas Herbst, Winfried Ranke und Jürgen Winkler (Hrsg.): So funktionierte die DDR. Band 2: Lexikon der Organisationen und Institutionen. Reinbek bei Hamburg, Rowohlt Taschenbuch Verlag 1994, S. 665f.