Henckel von Donnersmarck
Henckel von Donnersmarck ist eine österreichisch-deutsche Adelsfamilie. Sie hat ihren Ursprung in der früher oberungarischen Landschaft Zips (heute slowakisch Spiš), wo die Vorfahren einst als ungarndeutsche Siedler ansässig waren.

Die seit 1593 briefadelige Familie stieg zunächst durch Handel in Österreich, dann durch Bergbau in Oberschlesien zu großem Reichtum auf.
Geschichte
Stammvater der Familie ist ein im 14./15. Jahrhundert erwähnter Henckel de Quintoforo aus Donnersmark in der heutigen Slowakei, das seinen lateinischen wie auch seinen deutschen Namen dem Markt verdankt, der dort donnerstags stattfand.
Der deutsche und ungarische König Sigismund von Luxemburg verlieh den Brüdern Peter, Jakob und Nikolaus Henckel de Quintoforo am 1. August 1417 in Konstanz, zur Zeit des dort stattfindenden Konstanzer Konzils, ein Wappen.
Lazarus I. Henckel von Donnersmarck „der Ältere“ (1551–1624) ging nach Wien und begann als Faktor einer Ulmer Firma mit Waren- und Geldhandel, baute ab 1581 eine eigene Firma zum Großhandel mit Vieh, Tuchen und Wein auf, erwarb 1591 ein Weingut und später noch andere Ländereien. Eine ungarische Adelsbestätigung für das Gesamtgeschlecht mit „de Quintoforo, aliter von Donnersmarckh“ erfolgte am 27. April 1593. Lazarus I. vergab zwischen 1595 und 1600 hohe Kredite für die Türkenkriege an die kaiserliche Hofkammer und beteiligte sich 1603 an den Kupferbergwerken in Neusohl. 1607 wurde sein Adelsdiplom bestätigt, 1608 bekam er das Böhmische Inkolat, 1615 wurde er in den Freiherrenstand erhoben. Er legte als Finanzier Kaiser Rudolfs II. die eigentliche Basis für den Aufstieg der Familie. Obwohl er am lutherischen Glauben festhielt, bekleidete er hohe Ämter in Wien (Ratsmitglied, Stadtgerichtsbeisitzer). Kurz vor seinem Tod verpfändete Kaiser Ferdinand II. ihm 1623 die schlesischen Herrschaften Beuthen, Oderberg und Neudeck.
Sein Sohn, Lazarus II. (1573–1664), genannt Lazy, erwarb die Pfandgüter 1629 zu Eigentum. Er wurde am 18. Dezember 1636 in Regensburg von Kaiser Ferdinand II. ebenfalls zum erbländisch-österreichischen Freiherrn und zugleich zum Reichsfreiherrn erhoben mit dem Namen Henckel von Donnersmarck auf Gfell und Wesendorf. Am 29. Juli 1651 wurde er in Innsbruck vom Tiroler Landesfürsten Erzherzog Ferdinand Karl in den erbländisch-österreichischen Grafenstand erhoben. Am 5. März 1661 wurde ihm von Kaiser Leopold I. in Wien auch der böhmische Grafentitel verliehen.
1670 teilte die Familie ihr Erbe in die Fideikommisse Beuthen sowie Tarnowitz-Neudeck auf. Es entstanden dadurch die katholische Linie Beuthen-Siemianowitz und die protestantische Linie Tarnowitz-Neudeck. Am 14. November 1697 folgte in Wien die „Erhebung“ von Beuthen zur Freien Standesherrschaft.
Graf Carl Lazarus aus Neudeck (1772–1864) betrieb auf seinem Grundbesitz Steinkohlenbergbau und errichtete Eisen- und Zinkhütten sowie Walzwerke. Sein Sohn Guido erbte diese, übernahm die zuvor verpachteten Unternehmen in Eigenregie und weitete sie durch Gründung von Aktiengesellschaften erheblich aus, so die Vereinigte Königs- und Laurahütte. Er besaß 27.500 ha Land und war 1913 mit einem geschätzten Vermögen von 254 Millionen Mark die zweitreichste Person in Preußen nach Gustav Krupp von Bohlen und Halbach.[1] Graf Guido erhielt am 18. Januar 1901 in Berlin vom deutschen Kaiser Wilhelm II. den preußischen Fürstentitel als Graf Henckel, Fürst von Donnersmarck. Den Kaiser verband schon seit längerem eine Freundschaft mit Guido, den er regelmäßig auf Schloss Neudeck zur Jagd besuchte. Dieser errichtete am 8. Mai 1916 in einem notariellen Akt die Fürst Donnersmarck-Stiftung zur Unterstützung von Menschen mit Behinderung, damals als „Stiftung Fürst Donnersmarck-Institut zu Berlin“. Nach Fürst Guido ist das Bergwerksmuseum Guido benannt. Er starb 1916 und erlebte so nicht mehr die Abtretung Ostoberschlesiens an Polen als Folge des Versailler Vertrags. Die Familie wurde 1945 von den Kommunisten enteignet.
Besitzungen
Lazarus I. Henckel von Donnersmarck erwarb 1591 das niederösterreichische Weingut Nußdorf ob der Traisen und begann mit einem umfangreichen Weinhandel. Auch die Güter und Herrschaften Gföll (Gföhl), Wesendorf und Weißenkirch kamen zunächst als Pfand und schließlich ganz in seinen Besitz. 1623 vergab Kaiser Ferdinand II. in seiner Eigenschaft als König von Böhmen die Herrschaften Beuthen, Oderberg und Neudeck pfandweise an ihn, sein Sohn Lazarus II. erwarb sie 1629 zu Eigentum. Ab 1697 wurde das vormalige Herzogtum Beuthen dann in eine Freie Standesherrschaft für den Grafen Leo Ferdinand umgewandelt, die nach dem Ersten Schlesischen Krieg 1742 wie fast ganz Schlesien von Österreich an Preußen fiel.

1670 wurde das Familienerbe in die Fideikommisse Beuthen sowie Tarnowitz-Neudeck geteilt. Der erste Vertreter der protestantischen Tarnowitz-Neudecker Linie war Carl Maximilian Graf Henckel von Donnersmarck, der die alte Burg in Neudeck zwischen 1670 und 1680 im Renaissancestil umgestalten ließ; im 18. Jahrhundert wurde es barockisiert und im 19. Jahrhundert im Tudorstil erweitert. 1868 ließ Fürst Guido mit Schloss Neudeck ein neues, zweites Schloss erbauen. 1945 wurde der Besitz enteignet, die Schlösser zerstört.
Zum oberschlesischen Besitz gehörten auch Tarnowitz, Siemianowitz (wo 1835 die Laura-Hütte entstand), Annaberg, Polnisch Krawarn, Nakło Śląskie und Grambschütz, ferner das mährisch-schlesische Oderberg und das niederschlesische Romolkwitz sowie Schloss Hirschhügel in Thüringen. Seit 1846 ist Schloss Wolfsberg (Kärnten) im Besitz der Familie.
.jpg.webp) Schloss Siemianowitz
Schloss Siemianowitz.jpg.webp) Schloss Annaberg
Schloss Annaberg-palace.jpg.webp)
 Schloss Nakło
Schloss Nakło Schloss Brynek
Schloss Brynek
Wappen
Das Stammwappen zeigt in geteiltem Schild oben in Gold einen wachsenden gold-gekrönten blauen Löwen, unten in Rot drei (2:1) silberne Rosen. Auf dem Helm mit blau-goldenen Decken der Löwe wachsend.
 Stammwappen von Otto Hupp im Münchener Kalender von 1901
Stammwappen von Otto Hupp im Münchener Kalender von 1901 Wappen der Grafen Henckel von Donnersmarck
Wappen der Grafen Henckel von Donnersmarck.jpg.webp) Wappen der preußischen Fürsten Henckel von Donnersmarck 1901
Wappen der preußischen Fürsten Henckel von Donnersmarck 1901 Alternatives Wappen der preußischen Fürsten Henckel von Donnersmarck 1901
Alternatives Wappen der preußischen Fürsten Henckel von Donnersmarck 1901
Bekannte Familienmitglieder
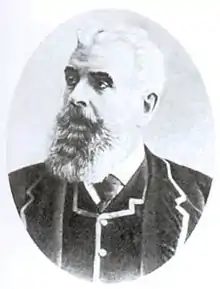
- Lazarus I. Henckel von Donnersmarck (1551–1624), Großhändler, Bankier und Bergbauunternehmer
- Lazarus III. Henckel von Donnersmarck (1729–1805), Standesherr und Montanindustrieller
- Lazarus Henckel von Donnersmarck (General) (1785–1876), deutscher Generalleutnant
- Lazarus Henckel von Donnersmarck (Diplomat) (1817–1887), deutscher Rittergutsbesitzer, Hofbeamter und Diplomat
- Lazarus IV. Henckel von Donnersmarck (1835–1914), deutscher Rittergutsbesitzer und Politiker (Zentrum), MdR
- Viktor Amadeus Henckel von Donnersmarck (1727–1793), General, Gouverneur von Königsberg
- Elias Maximilian Henckel von Donnersmarck (1748–1827), preußischer Generalmajor
- Eleonore Maximiliane Ottilie Henckel von Donnersmarck, geb. von Lepel (1756–1843), seit 1804 Oberhofmeisterin in Weimar
- Carl Lazarus Henckel von Donnersmarck (1772–1864), deutscher freier Standesherr und Industrieller
- Wilhelm Ludwig Viktor Henckel von Donnersmarck (1775–1849), preußischer Generalleutnant
- Henriette Ulrike Ottilie von Pogwisch (1776–1851), geborene Henckel von Donnersmarck, Mutter der Ottilie von Goethe
- Leo Victor Felix Henckel von Donnersmarck (1785–1861), deutscher Botaniker
- Hugo Henckel von Donnersmarck (1811–1890), Land- und Industriebesitzer
- Pauline Henckel von Donnersmarck (Marquise de Païva oder La Païva; * 1819 als Esther Lachmann, † 1884), Pariser Lebedame und französische Kurtisane
- Guido Graf Henckel, Fürst von Donnersmarck (1830–1916), Land- und Industriebesitzer
- Viktor Henckel von Donnersmarck (1854–1916), deutscher Diplomat
- Hugo III. Henckel von Donnersmarck (1857–1923), deutscher Magnat und Offizier
- Katharina Henckel von Donnersmarck (* 1862 als Katharina Slepzow, † 1929), zweite Ehefrau von Guido Henckel von Donnersmarck
- Edwin Henckel von Donnersmarck (1865–1929), Montanunternehmer und Mitglied des Preußischen Abgeordnetenhauses (Zentrum)
- Margarete Szápáry (1871–1943), katholische Frauenbewegung (geboren als Margarete Henckel von Donnersmarck, Ehefrau von Sandor Graf Szapáry)
- Odo Deodatus I. Tauern (1885–1926), Ethnologe, Stammvater der Nebenlinie Tauern des Adelsgeschlechts Henckel von Donnersmarck
- Georg Graf Henckel von Donnersmarck (1902–1973), Mitglied des Deutschen Bundestages
- Augustinus Heinrich Graf Henckel von Donnersmarck (1935–2005), Priester, Prämonstratenser, Unternehmensberater
- Leo-Ferdinand Graf Henckel von Donnersmarck (1935–2009), 1997 bis 2006 Präsident der Deutschen Assoziation des Malteserordens, 2003–2009 Mitglied im Kuratorium der Fürst Donnersmarck-Stiftung
- Gregor Henckel-Donnersmarck (Ulrich Maria Karl Graf Henckel von Donnersmarck) (* 1943), 67. Abt des Stiftes Heiligenkreuz
- Florian Henckel von Donnersmarck (* 1973), Filmregisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent
- Anna Henckel-Donnersmarck (* 1973), deutsche Filmschaffende und Kuratorin
Literatur
- Constantin von Wurzbach: Henckel von Donnersmarck, die Grafen, Genealogie. In: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich. 8. Theil. Kaiserlich-königliche Hof- und Staatsdruckerei, Wien 1862, S. 300 f. (Digitalisat).
- Constantin von Wurzbach: Henckel von Donnersmarck, die Grafen, Wappen. In: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich. 8. Theil. Kaiserlich-königliche Hof- und Staatsdruckerei, Wien 1862, S. 302 (Digitalisat).
- Hugo Reichsgraf Henckel Freiherr von Donnersmarck und die Geschichte seines Hauses. Wien nach 1890?
- Henckel von Donnersmarck Hugo. In: Österreichisches Biographisches Lexicon 1815–1950. Band II, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 1959.
- H. Nussbaum: Henckel von Donnersmarck Graf (seit 1901 Fürst) Guido. In: Karl Obermann, Heinrich Scheel u. a. (Hrsg.): Biographisches Lexikon zur Deutschen Geschichte. Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin 1967.
- Alfons Perlick: Henckel von Donnersmarck. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 8, Duncker & Humblot, Berlin 1969, ISBN 3-428-00189-3, S. 516 (Digitalisat).
- Genealogisches Handbuch des Adels. Adelslexikon. Band V, Band 84 der Gesamtreihe, S. 112–114, C. A. Starke Verlag, Limburg (Lahn) 1984, ISSN 0435-2408.
- J. Bitta: Guido Graf Henckel Fürst von Donnersmarck. In: Schlesier des 19. Jahrhunderts. (= Schlesische Lebensbilder; Band 1). Hrsg. von der Historischen Kommission für Schlesien von Friedrich Andreae, 2. Auflage. Thorbecke, Sigmaringen 1985 ISBN 3-7995-6191-9.
- Arkadiusz Kuzio-Podrucki: Henckel von Donnersmarckowie. Kariera i fortuna rodu. Rococo, Bytom 2003 ISBN 83-86293-41-1 (polnisch).
- Jarosław Aleksander Krawczyk, Arkadiusz Kuzio-Podrucki: Zamki i pałace Donnersmarcków. Schlösser der Donnersmarcks. 2. Auflage, Drukarnia Skill, Bytom 2003 ISBN 83-86293-41-1 (deutsch und polnisch).
- Manfred Rasch: Der erste Walzdraht der Niederrheinischen Hütte 1913 – Guido Henckel von Donnersmarck und Bernhard Grau. stahl und eisen 133 (2013), Nr. 11, S. 256–259.
- Hoch-Adeliche Stam[m]-Taffeln: Nach Ordnung des Alphabets, Band 3, 1726, S. 12f.
- Europäisches genealogisches Handbuch 1754. S. 177f.
- Gothaisches genealogisches Taschenbuch der gräflichen Häuser 1876. S. 361ff.
Weblinks
- Henckel von Donnersmarck in Paul Theroffs Online Gotha
- Stammtafeln von der Familie: M.Marek Genealogy of Henckel von Donnersmarck in M.Marek, Genealogy.Eu
- Publikationen von und über Henckel von Donnersmarck im Bibliotheks- und Bibliographieportal / Herder-Institut (Marburg)
- Zeitungsartikel über Henckel von Donnersmarck in der Pressemappe 20. Jahrhundert der ZBW – Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft
Einzelnachweise
- Rudolf Martin: Jahrbuch des Vermögens und Einkommens der Millionäre im Königreich Preußen. 2. Bde., Berlin 1913, zitiert nach: Rudolf Vierhaus, Bernhard vom Brocke (Hrsg.): Forschung im Spannungsfeld von Politik und Gesellschaft. Geschichte und Struktur der Kaiser-Wilhelm-/Max-Planck-Gesellschaft. DVA, Stuttgart 1990, ISBN 3-421-02744-7, S. 45.