Europäisches Astronautenkorps
Das Europäische Astronautenkorps ist die Gruppe der aktiven Astronauten der europäischen Weltraumorganisation (ESA). Hauptsitz des Korps, das derzeit aus 7 Mitgliedern besteht, ist das Europäische Astronautenzentrum in Köln. Oft sind die Astronauten aber an verschiedenen Orten in der Welt eingesetzt, z. B. beim Europäischen Weltraumforschungs- und Technologiezentrum (ESTEC) in Noordwijk, am Johnson Space Center der NASA in Houston, oder am Juri-Gagarin-Kosmonautentrainingszentrum im russischen Sternenstädtchen.

Geschichte
Die ESA begann ihr bemanntes Raumflugprogramm mit Spacelab, für das 1978 die ersten ESA-Astronauten ausgewählt wurden. Die ersten drei Astronauten, die ausgewählt wurden, waren der Deutsche Ulf Merbold, der Niederländer Wubbo Ockels und der Schweizer Claude Nicollier.
Ulf Merbold flog 1983 mit der Space-Shuttle-Mission STS-9 als erster ins All. Wubbo Ockels flog zwei Jahre später. Claude Nicollier musste 14 Jahre auf seine erste Mission STS-46 warten, inzwischen hat er aber mit vier Raumflügen die anderen überholt.
Die zweite ESA-Auswahl erfolgte 1992 aufgrund zweier großer ESA-Projekte: Hermes (inzwischen eingestellt) und Columbus. Mehr als 22.000 Interessenten und davon 5.500 ernsthafte Kandidaten gab es für diese Astronautenauswahl. Sechs Kandidaten wurden schließlich ausgewählt, inklusive eines bereits von der französischen Raumfahrtbehörde CNES ausgewählten Astronauten: Jean-François Clervoy aus Frankreich. Die anderen fünf waren Thomas Reiter aus Deutschland, Maurizio Cheli aus Italien (1996 ausgeschieden), Pedro Duque aus Spanien, Christer Fuglesang aus Schweden und die erste Frau, Marianne Merchez aus Belgien, die aber bald wieder ausschied und nicht in den Weltraum flog.
Am 25. März 1998 entschied der ESA-Ministerrat ein gemeinsames Europäisches Astronautenkorps zu bilden. Das Ziel war die Verbesserung der Organisation innerhalb des Programms für die Internationale Raumstation (ISS). Deutschland und Frankreich, die als einzige europäische Länder ein eigenes Astronautenkorps hatten, erachteten die Fusion als notwendigen Schritt um die Koordination der Astronauten zu optimieren. Die Entscheidung des ESA-Ministerrats beinhaltete die Schaffung eines Korps mit 16 Astronauten (jeweils vier aus Deutschland, Frankreich und Italien und vier für die anderen Mitgliedstaaten). Der Integrationsprozess sollte mit der Auflösung der nationalen Astronautenkorps bis Ende Juni 2000 einhergehen. Die Vereinbarung schließt nicht aus, dass ein Mitgliedstaat für ein nationales Raumfahrtprojekt auf Astronauten des Europäischen Astronautenkorps zurückgreifen kann.
Weitere Astronauten kamen in den Jahren von 1998 bis 2000 zum Europäischen Astronautenkorps. Am 10. April 2008 gab die ESA bekannt, dass eine Vergrößerung der Astronautengruppe, die inzwischen auf acht Mitglieder geschrumpft war, geplant sei. Bewerben konnten sich vom 19. Mai bis 18. Juni 2008 Personen aus allen 17 Mitgliedstaaten der ESA. Bis zum Bewerbungsschluss waren 8413 ernsthafte Bewerbungen aus allen ESA-Mitgliedsländern eingetroffen. Davon kamen 22,1 % aus Frankreich, 21,6 % aus Deutschland, 11,0 % aus Italien und 4,2 % aus der Schweiz. Von allen Bewerbungen waren nur 1430 von Frauen. Nachfolgend wurden 918 Personen für den psychologischen Test der ersten Stufe ausgewählt von denen 192 eine Einladung zur zweiten Teststufe bekamen. Die neue Astronautengruppe wurde am 20. Mai 2009 im ESA-Hauptquartier in Paris der Öffentlichkeit vorgestellt. Als neue Astronauten begannen die Italienerin Samantha Cristoforetti, der Deutsche Alexander Gerst, der Däne Andreas Mogensen, der Italiener Luca Parmitano, der Brite Timothy Peake und der Franzose Thomas Pesquet die Grundausbildung, um ab 2013 Missionen zur ISS und eventuell auch zum Mond zu bestreiten.
Mitglieder
Das Europäische Astronautenkorps bestand im September 2020 aus 7 Raumfahrern: zwei aus Italien, zwei aus Deutschland, sowie je einem aus Frankreich, Dänemark und Großbritannien. Die nächste Rekrutierungsphase war damals für Anfang 2021 geplant.[1]
Aktive Mitglieder
| Astronaut | Nationalität | Eintrittsdatum | Missionen | Zeit im All | Bild |
|---|---|---|---|---|---|
| Samantha Cristoforetti | 20. Mai 2009 |
|
199d 16h 43min |  | |
| Alexander Gerst | 20. Mai 2009 |
|
362d 1h 51min |  | |
| Matthias Maurer | 1. Juli 2015 |
|
 | ||
| Andreas Mogensen | 20. Mai 2009 |
|
9d 20h 14m |  | |
| Luca Parmitano | 20. Mai 2009 |
|
366d 23h 3min |  | |
| Timothy Peake | 20. Mai 2009 |
|
185d 22h 11min |  | |
| Thomas Pesquet | 20. Mai 2009 |
|
196d 17h 49min |  | |
Ehemalige Mitglieder
| Astronaut | Nationalität | Eintrittsdatum | Missionen | Austrittsdatum | Zeit im All | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maurizio Cheli | 15. Mai 1992 |
|
30. Juni 1996 | 15d 17h 41min |  | |
| Jean-François Clervoy | 15. Mai 1992 | 28d 3h 5min |  | |||
| Frank De Winne | Januar 2000 |
|
1. August 2012 | 198d 17h 34min |
 | |
| Pedro Duque | 15. Mai 1992 |
|
18d 18h 46min |  | ||
| Reinhold Ewald | Februar 1999 |
|
2007 | 19d 16h 34min |  | |
| Léopold Eyharts | 1. August 1998 |
|
68d 20h 30min |  | ||
| Christer Fuglesang | 15. Mai 1992 | 26d 17h 38min |  | |||
| Umberto Guidoni | 1. August 1998 | Juli 2004 | 27d 15h 12min |  | ||
| Claudie Haigneré | 1. November 1999 |
|
18. Juni 2002 | 25d 14h 22min | 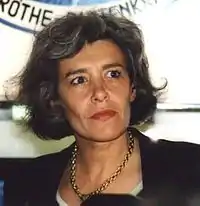 | |
| Jean-Pierre Haigneré | 1. Juni 1998 |
|
November 1999 | 209d 12h 25min |  | |
| André Kuipers | Juli 1999 |
|
203d 15h 51min |  | ||
| Ulf Merbold | 1978 |
|
30. August 1998 | 49d 21h 36min |  | |
| Marianne Merchez | 15. Mai 1992 |
|
1995 | |||
| Paolo Nespoli | 1. August 1998 |
|
November 2018 | 313d 02h 36min |  | |
| Claude Nicollier | Juli 1978 | März 2007 | 42d 12h 5min | .jpg.webp) | ||
| Wubbo Ockels | 1978 |
|
1986 | 7d 0h 44min |  | |
| Philippe Perrin | Dezember 2002 |
|
Mai 2004 | 13d 20h 35m |  | |
| Thomas Reiter | 15. Mai 1992 |
|
Oktober 2007 | 350d 4h 55min |  | |
| Hans Schlegel | 1. August 1998 | 22d 18h 2min |  | |||
| Gerhard Thiele | 1. August 1998 |
|
Oktober 2005 | 11d 5h 39min |  | |
| Michel Tognini | 1. November 1999 |
|
Mai 2003 | 18d 17h 46min |  | |
| Roberto Vittori | 1. August 1998 |
|
35d 12h 26min |  | ||
Einzelnachweise
- ESA: EAC Frequently Asked Questions. Abgerufen am 6. September 2020 (englisch): „The next recruitment round is expected to begin early 2021“
Weblinks
- Offizielle ESA-Seite (englisch)
- ESA Astronaut Selection Brochure (englisch, PDF-Datei, 7 MB, 42 Seiten)