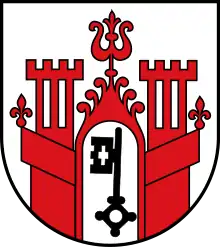Bad Fredeburg
Bad Fredeburg (bis 1995 Fredeburg) ist ein Ortsteil der Stadt Schmallenberg im Hochsauerlandkreis in Nordrhein-Westfalen.
Bad Fredeburg Stadt Schmallenberg | ||
|---|---|---|
 Wappen von Bad Fredeburg | ||
| Höhe: | 448 m | |
| Fläche: | 13,33 km² | |
| Einwohner: | 3953 (31. Dez. 2020)[1] | |
| Bevölkerungsdichte: | 297 Einwohner/km² | |
| Eingemeindung: | 1. Januar 1975 | |
| Postleitzahl: | 57392 | |
| Vorwahl: | 02974 | |
Lage von Bad Fredeburg in Schmallenberg | ||
.JPG.webp) Bad Fredeburg Bad Fredeburg | ||
Geographie
Ortschaft
Bad Fredeburg ist ein Luftkurort im Rothaargebirge und ein Kneippheilbad. Der Ort wird dem Schmallenberger Sauerland zugeordnet.
Klima
Das Klima im 450 bis 818 m hoch gelegenen Bad Fredeburg kann als Mittelgebirgsklima mittlerer Stufe eingeordnet werden.
Geschichte


Im 14. Jahrhundert fehlte den Edelherren von Bilstein im östlichen Bereich ihres Gebietes ein befestigtes Zentrum. Aus diesem Grund erbaute Edelherr Dietrich III. von Bilstein in den ersten Jahrzehnten des 14. Jahrhunderts die Fredeburg. Vermutlich kam es zur gleichen Zeit zur Gründung einer kleinen Stadt außerhalb der Burg.
Nach dem Aussterben des Adelsgeschlechts fiel die Burg in den Besitz des Grafen Gottfried IV. von Arnsberg. Der erbaute im Jahre 1353 eine Kaplanei an die Fredeburger Kapelle. Nach einer Fehde mit Engelbert III. von der Mark musste Graf Gottfried IV. Fredeburg 1366 an diesen abtreten. In den folgenden Jahrzehnten der märkischen Herrschaft gab es in Fredeburg andauernd Unruhen.
Ruhe kehrte erst 1444 wieder ein, als es Erzbischof Dietrich von Moers in der Soester Fehde gelang, Fredeburg zu erobern. Im Jahre 1562 ging die Stadt als Lehen in den Besitz eines Zweiges der Familie von Bruch über, die schon eine lange Reihe von Burgmannen und Drosten in Fredeburg gestellt hatte.

Im 17. Jahrhundert kam es im Amt Fredeburg und in Fredeburg zu zahlreichen Hexenprozessen.[2] Ein Opfer der Hexenverfolgung war Ursel vom Gerwenhof. In der Nähe der Femelinde des Ortes steht eine im 18. Jahrhundert erbaute Kapelle. Dieses „Hexenkapelle“ genannte Gebäude soll an der Stelle stehen, an der die zum Tode verurteilten Hexen unmittelbar vor ihrer Hinrichtung Trost und Stärke erfleht haben. Die Kapelle wurde 2005/2006 renoviert.[3]
Ein Stadtbrand vernichtete im Jahre 1810 die gesamte Altstadt. Im Frühjahr 1945 wurde Fredeburg im Zweiten Weltkrieg erneut beträchtlich zerstört. Bei der kommunalen Neugliederung in Nordrhein-Westfalen, die am 1. Januar 1975 in Kraft trat, verlor die Stadt ihre Selbstständigkeit und wurde ein Ortsteil der Stadt Schmallenberg.[4] Seit 1995 ist Fredeburg ein Kneippheilbad.
Politik
Wappen
 |
Blasonierung:
In Blau eine silberne Burg mit offenem Tor und drei Zinnentürmen mit schwarzen Spitzdächern; der mittlere über rundem Unterbau sechseckig mit zwei Zinnenkränzen, die gezinnten Seitentürme rund. Beschreibung: Das Wappen entspricht der Zeichnung der Arnsberger Wappensammlung, die sich auf das Bild eines Siegelabdrucks von 1539 stützt. Die Farben Blau-Silber und Silber-Schwarz erinnern an die frühere Zugehörigkeit zur Grafschaft Arnsberg und zum Kurfürstentum Köln. Die amtliche Genehmigung erfolgte am 18. April 1911.[5] |
Einrichtungen
Öffentliche Einrichtungen

Das Amtsgericht Schmallenberg und die Polizeiwache Schmallenberg sowie die Kurverwaltung, das Musikbildungszentrum Südwestfalen, das Sauerlandbad, die Stadtsparkasse Schmallenberg, die Rettungswache und das DRK Stadtverband Schmallenberg befinden sich in Bad Fredeburg.
Krankenhäuser/Fachkliniken
Die Internistisch-Psychosomatische Fachklinik Hochsauerland mit ihrer langjährigen Tradition in der Rehabilitation psychosomatisch Kranker ist in Bad Fredeburg angesiedelt. Die Fachklinik Hochsauerland steht im engen organisatorischen Verbund mit der Fachklinik Fredeburg, einem der größten Therapiezentren für Abhängigkeitserkrankungen. Das ursprünglich in gleicher Trägerschaft befindliche St.-Georg-Krankenhaus schloss 2012 infolge einer Insolvenz.
Schwimmbad
Das Sauerlandbad in Bad Fredeburg verfügt über verschiedene Schwimmbecken, zwei Rutschen, drei Gastronomiebereiche und eine großzügig angelegte Saunalandschaft.
Schulen
Fredeburg verfügt über ein Schulzentrum mit Realschule, eine (katholische) Grundschule sowie das private Internat Fredeburg, dessen Schüler allerdings die örtlichen öffentlichen Schulen besuchen.
Industrie
Das börsenorientierte Unternehmen burgbad, ein Produzent von Badmöbeln, Licht-Sicht-Systemen und Waschtischen, hat seinen Konzernsitz in Bad Fredeburg. Die Firma Magog unterhält die einzige heute noch produzierende Schiefergrube (Fredeburger Schiefer) in Nordrhein-Westfalen.
Kurort
Neben bewährten Therapien und medizinischen Anwendungen werden in Bad Fredeburg eine Vielzahl ambulanter Angebote Aquafitness, Rückenschule, Powergymnastik, Wandern, Walking oder Nordic Walking durchgeführt, die der Prävention dienen. Eine zusätzliche therapeutische Besonderheit ergibt sich in Bad Fredeburg aus der Speläotherapie im Abela-Heilstollen.
Heilig-Kreuz-Kapelle
Sehenswert ist die Pfarrkapelle Heilig-Kreuz.
 Kapelle Bad Fredeburg
Kapelle Bad Fredeburg Innenansicht Kapelle Bad Fredeburg
Innenansicht Kapelle Bad Fredeburg Eingangsportal Kapelle Bad Fredeburg
Eingangsportal Kapelle Bad Fredeburg
Verkehr
Der Bahnhof Fredeburg lag an der Bahnstrecke Altenhundem–Wenholthausen. Der Personenverkehr endete bereits 1964 und die Gleise waren bis 2006 abgebaut.Durch Bad Fredeburg verläuft außerdem die Bundesstraße 511, hier beginnt auch die wichtige überregionale Landesstraße 776 in Richtung Bestwig, Rüthen, Paderborn.
Söhne und Töchter der Stadt
- Joseph Hengesbach (1860–1940), katholischer Publizist
- Franz Schäfer (1879–1958), Jurist und Hochschullehrer
- Rudolf zur Bonsen (1886–1952), Verwaltungsjurist und Regierungspräsident
- Bernhard Menne (1901–1968), Journalist und Publizist (u. a. Chefredakteur der Welt am Sonntag)
- Josef Schüttler (1902–1972), Politiker der CDU (MdL von 1946 bis 1949, danach von 1949 bis 1960 Mitglied des Bundestages, anschließend von 1960 bis 1968 Arbeitsminister in Baden-Württemberg)
- Michael Soeder (1921–2008), Arzt und Schriftsteller
- Dieter Ruddies (1921–2015), Kommunalpolitiker und Unternehmer
- Karl Föster (1915–2010), Autor und Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande
- Paul Tigges (1922–2006), Autor und Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande
- Pater Paul-Heinz Guntermann (1930–2006), Referent im Katholischen Auslandssekretariat der Deutschen Bischofskonferenz und war von 1981 bis 1993 dessen Leiter.
- Günther Schauerte (* 1954), Archäologe und stellvertretender Generaldirektor der Staatlichen Museen zu Berlin
- Heribert Vollmer (* 1964), Informatiker und Hochschullehrer
Literatur
- Heinz Hellmich: Mit Zimt und Zucker. Erinnerungen aus Fredeburg 1941–1954. Sammlung der Zeitzeugen. Zeitgut, Berlin 2006, ISBN 3-933336-97-X
Weblinks
- Prof. Dr. Albert Hömberg: Geschichte der Stadt Fredeburg. Abgerufen am 19. Juli 2019.
- Bad Fredeburg
Einzelnachweise
- Einwohnerzahlen Schmallenberg 2020, abgerufen am 30. März 2021
- Namen der Opfer der Hexenprozesse/ Hexenverfolgung Bad Fredeburg (PDF; 17 kB), abgerufen am 9. Mai 2016.
- Hartmut Hegeler: Hexendenkmäler im Sauerland. In: Sauerland 4/2008, S. 173
- Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Historisches Gemeindeverzeichnis für die Bundesrepublik Deutschland. Namens-, Grenz- und Schlüsselnummernänderungen bei Gemeinden, Kreisen und Regierungsbezirken vom 27.5.1970 bis 31.12.1982. W. Kohlhammer, Stuttgart/Mainz 1983, ISBN 3-17-003263-1, S. 335 f.
- Eduard Belke, Alfred Bruns, Helmut Müller: Kommunale Wappen des Herzogtums Westfalen. Arnsberg 1986, S. 147, ISBN 3-87793-017-4