Picrotoxin
Picrotoxin, auch als Cocculin bekannt, ist der Name für ein äquimolares Gemisch aus zwei natürlich vorkommenden chemischen Verbindungen: Picrotoxinin, C15H16O6 und Picrotin[2], C15H18O7, beides Sesquiterpenlactone aus der Scheinmyrte. Picrotoxin wurde erstmals 1812 von Boullay aus den Früchten („Kokkelskörner“) der Pflanze isoliert.

| Strukturformel | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
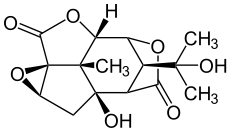  | ||||||||||||||||||||||
| Picrotin (oben), Picrotoxinin (unten) | ||||||||||||||||||||||
| Allgemeines | ||||||||||||||||||||||
| Name | Picrotoxin | |||||||||||||||||||||
| Andere Namen |
Cocculin | |||||||||||||||||||||
| Summenformel | C15H16O6 · C15H18O7 | |||||||||||||||||||||
| Kurzbeschreibung |
weißes bis gelbliches Pulver[1] | |||||||||||||||||||||
| Externe Identifikatoren/Datenbanken | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||
| Molare Masse | 292 und 310 g·mol−1 | |||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand |
fest | |||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt | ||||||||||||||||||||||
| Löslichkeit |
4,1 g·l−1 [3] | |||||||||||||||||||||
| Sicherheitshinweise | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Toxikologische Daten | ||||||||||||||||||||||
| Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. | ||||||||||||||||||||||
Eigenschaften
Der Bestandteil Picrotin unterscheidet sich vom Picrotoxinin nur darin, dass in der Struktur die Doppelbindung der Isopropenylgruppe hydratisiert ist, das heißt statt eines Isopropenyl- ein 2-Hydroxyisopropylrest vorliegt. Im Gegensatz zum ungiftigen Picrotin ist Picrotoxinin hochgiftig; die letale Dosis für einen Menschen beträgt etwa 20–25 mg.[2][5] Es ist damit für den Menschen giftiger als andere Toxine, beispielsweise Strychnin. Beim Menschen erzeugten nichtletale Mengen Erregung, Schläfrigkeit und Veränderungen im Magen-Darm-Trakt,[5] bei Tieren wie Mäusen ebenfalls Erregung, Krämpfe und Auswirkungen auf das Größenwachstum.[4]
Picrotoxinin wirkt als nichtkompetitiver GABAA-Rezeptor-Antagonist. Da GABA (γ-Aminobuttersäure) ein inhibitorischer Neurotransmitter ist, hat Picrotoxinin einen stimulativen Effekt. Picrotoxin wurde früher als Antidot bei Barbituratvergiftung benutzt. Eine neue Behandlungsmöglichkeit des Morbus Menière benutzt Picrotoxin.[6] Vergiftungen mit Picrotoxin werden mit Diazepam und wenn nötig Barbituraten wie Phenobarbital behandelt.[7]
Literatur
- Dupont, L.; Dideberg, O.; Lamotte-Brasseur, J.; Angenot, L.: Structure Cristalline et Moléculaire de la Picrotoxine, C15H16O6 · C15H18O7. In: Acta Crystallographica B. 32, Nr. 11, 1976, S. 2987–2993. doi:10.1107/S0567740876009424. (in Französisch)
Weblinks
- TCDB: Picrotoxin
Siehe auch
- Das Bicucullin der Herzblumen und der synthetische Wirkstoff Gabazin sind ebenfalls GABAA-Rezeptor-Antagonisten.
- Das Pharmazeutikum Baclofen und Muscimol, einer der Giftstoffe des Fliegenpilzes sind GABA-Rezeptor-Agonisten.
Einzelnachweise
- Datenblatt Picrotoxin bei Sigma-Aldrich, abgerufen am 20. April 2011 (PDF).
- Eintrag zu Picrotoxin. In: Römpp Online. Georg Thieme Verlag, abgerufen am 16. Juni 2014.
- Eintrag zu Picrotoxin in der ChemIDplus-Datenbank der United States National Library of Medicine (NLM)
- Setnikar, I.; Murmann, W.; Magistretti, M. J.; Da Re, P.: Amino-methylchromones, Brain Stem Stimulants and Pentobarbital Antagonists. In: Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics. 128, 1960, S. 176–181. PMID 14445192.
- Deichmann, W. B.: Toxicology of Drugs and Chemicals. Academic Press, New York 1969, S. 476.
- Weikert, S.; Hoelzl, M.; Scherer, H.: Picrotoxin als Therapeutikum bei M. Menière?. In: Thieme Verlag (Hrsg.): HNO-Informationen (Kongressabstracts). 84, Nr. 1, 2005. doi:10.1055/s-2005-869101.
- Eintrag zu Picrotoxin in der Hazardous Substances Data Bank, abgerufen am 27. Oktober 2014 (online auf PubChem).