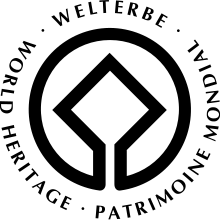Pasargadae

Die altpersische Residenzstadt Pasargadae oder Pasargad (persisch پاسارگاد, DMG Pāsārgād; altgriechisch Πασαργάδαι Pasargádai, lateinisch Pasargadai) liegt in 1900 m Höhe auf der Murghab-Ebene im Zagrosgebirge der Persis (Provinz Fars) und war die erste Residenz der Achämeniden, etwa 130 km nordöstlich von Schiras.
Name
Der elamitische Name lautet Batrakataš. Die heutige geläufige Bezeichnung ist eine griechische Transkription des altpersischen Namens Pâthragâda.
Die Entwicklung der Architektur im südwestlichen Iran
Aufgrund von einer Reihe von Ausgrabungen hat man heute eine ungefähre Vorstellung von der traditionellen iranischen Architektur vor den Achämeniden. Vom 8. bis 6. Jahrhundert legte man große Felsbrocken direkt auf den Boden. Flache Steine wurden unter die Säulen aus Holz gestellt und um die Sockel Lehmziegel und Gips geschichtet. Holz wurde für die Säulen, Sparren, Türstürze und Treppen verwendet, Lehmziegel für die oberen Wände und Bögen. Schmale Fenster in der Breite eines Bleistifts und Schießscharten prägten das Bild gegen außen, während Türöffnungen, Wandaussparungen und blinde Fenster dem Innern vorbehalten waren.[1]
Die Ruinen von Pasargadae, dem ältesten der Paläste der Achämenidenkönige, sind Ausdruck einer grundlegenden Änderung in der Bautätigkeit im Südwesten Irans und Zeugnis einer herausragenden Steintechnik, deren Herkunft in Lydien und Ionien lag. Die riesigen Steine der Fassade der Plattform von Tall-i Takht wurden ohne Mörtel zusammengefügt, wobei sich die Steinmetze einer fortschrittlichen Fugentechnik bedienten, Anathyrosis genannt. Diese Technik ermöglicht ein stabiles Produkt mit minimalem Aufwand, in dem nur die Randstreifen geglättet und abgeglichen werden.[2]
Die Anlage
Tall-i Takht
.jpg.webp)

Eine mit Steinen ausgeebnete Plattform befindet sich im Westen des Tall-i Takht, dem Thronhügel. Sie ist lokal bekannt unter dem Namen „Takht-i Madar-i Sulaiman“ (der Thron der Mutter von Salomo). Die Plattform misst im Norden 66 m, im Westen 79 m und im Süden 98 m. Die historischen Bautätigkeiten können in vier Perioden unterteilt werden: Periode I bezeichnet die Bautätigkeit unter Kyros II. Periode II umfasst ausgedehnte Lehmziegelkonstruktionen vom späten 6. bis zum frühen 3. Jahrhundert v. Chr. Periode III ist der Beleg für eine dritte Wiederbesetzung und Periode IV zeigt Spuren einer befestigten vor-islamischen Besiedelung.[3]
Von den baulichen Überresten der Periode I können drei Schichten unterschieden werden: eine äußere und innere Mauer mit einem Kern. Die äußere Mauer bestand aus behauenen Kalksteinen mit verschiedenen Längen, die bis zu zwanzig Mal übereinander arrangiert waren und dort eine Höhe von 14,5 m erreichten. Sie bestand aus rechteckigen Steinquadern von gleicher Höhe und unterschiedlicher Längen, die ohne Mörtel behauen und übereinander aufgeschichtet wurden. Überall dort, wo die Fassade mehr als ein paar Meter über dem Boden lag, wurde jede vertikale Verbindung mit einem Paar Schwalbenschwanzklammern aus Eisen und Blei verstärkt. Gerade diese Klammern waren in späterer Zeit ein begehrtes Gut, so dass an vielen Stellen die gewaltsame Entfernung der Klammern zu sehen ist. Die innere Mauer enthielt grob behauene rötliche Sandsteine in verschiedenen Formen und Größen. Im Kern wurden kleine dunkelgraue Kalksteine verwendet.
Ein Teil einer Brüstung im Süden ist erhalten geblieben. Sie besteht aus schweren Steinblöcken und ist mit Paneelen und Aufhängeleisten ausstaffiert. Ob Kyros II. geplant hatte, um die ganze Plattform eine Brüstung zu bauen, ist nicht klar.[4]
Auf der Nordseite wurden im 20. Jahrhundert von Archäologen zwei breite Treppen entdeckt, A und B. Sie deuten darauf hin, dass die Plattform nicht als befestigter und unbezwingbarer Stützpunkt vorgesehen war. Die Treppe B wurde 1951 von einem iranischen Team unter der Leitung von Ali Sami Shirazi und die Treppe A 1961 von britischen Archäologen ausgegraben. Die Treppe A weist eine Breite von 5,5 m auf, die Höhe einer Treppenstufe misst 26 cm und eine Tiefe von 53 cm. Die Treppe B weist eine Breite von 5,85 m auf, die Höhe einer Treppenstufe misst wie die Treppe A 26 cm und eine Tiefe von 53 cm.[5]
In die Mauer von Tall-i Takht wurden über 70 verschiedene Zeichen von Steinmetzen eingeritzt, die auf zwei verschiedene Baugruppen hindeuten. Sie zeigen Kreise, Kreuze und L-förmige Zeichen, die bereits von fragmentarischen Mauern vom lydischen Palast in Sardis bekannt sind. Es gibt Parallelen zwischen den Zeichen und östlichen-griechischen und anatolischen Siegeln, Münzen und bemalten Vasen.[6]
Das Basiswissen für das Mauerwerk der Plattform von Tall-i Takht stammt von Lydien und Ionien. Das Wissen um diese Technik kann erst ab 546 v. Chr. erfolgt sein, als die persische und griechische Kultur in einen kontinuierlichen Kontakt kam. Die Zeichen der Steinmetze deuten darauf hin, dass diese direkt vom unvollendeten Tempel der Artemis in Ephesos nach Pasargadae gebracht wurden. Die weiten Enden der Schwalbenschwanzklammern und die Abwesenheit des Zahnmeißels zeigen, dass die Arbeiten an der Plattform von kurzer Dauer waren. Der Zahnmeißel ist in Griechenland erst um 570 v. Chr. sichtbar und in Pasargadae nur vereinzelt zu erkennen. Erst ab 530 v. Chr. gewinnt das Werkzeug im Iran an Popularität, bevor es eine generelle Akzeptanz zu Beginn des 5. Jahrhunderts v. Chr. erlangt. Der Bau der Plattform von Tall-i Takht wird aus diesen Gründen zeitlich auf 546 bis 530 v. Chr. festgelegt.[7]
Das Grabmal von Kyros II.

Mit einer gewissen Distanz zu den übrigen Gebäuden dominiert das Grabmal von Kyros II. den Süden der Murghab-Ebene und zieht von überall her den Blick auf sich. Mit seinen monumentalen Steinblöcken und dem Fehlen von Dekorationen strahlt es „Würde, Einfachheit und Kraft“ aus. Seine Höhe mit den Treppen und der Grabkammer betrug wahrscheinlich über 11 m. Die unterste Stufe hat eine Höhe von 1,65 m, die zweite und dritte 1,05 m und die letzten drei je 57,5 cm. Die Grabkammer misst an der Basis 6,4 m Länge und 5,35 m Breite. Die Mauern sind 1,5 m dick. Die Türe ist 1,39 m hoch und 78 cm breit.[8]
Mit seinen Dimensionen, seiner Erscheinung und in den Details weist es anatolische Einflüsse, im Besonderen lydische und ionische Merkmale, auf. Nimmt man noch die Form der elamischen Zikkurat hinzu, erscheint das Grab als griechische, anatolische und iranische Synthese. Mit der Einführung einer neuen Bauweise und dem Beiziehen von Arbeitern aus vielen Ländern war es „zweifellos“ die Absicht von Kyros II., mit seinem Grab auf die Einzigartigkeit des achämenidischen Reichs hinzuweisen. Die Grabstätte wird auf 540 bis 530 v. Chr. datiert.[9]
Das Tor R


Das Tor R steht im östlichen Teil des Palastbezirks von Pasargadae. Die Bezeichnung R stammt von Ernst Herzfeld, der den Bau als Palast R, der Palast mit dem Relief, bezeichnet hat. Ursprünglich war das Tor R ein rechteckiger Bau von 28,5 m Länge und 25,5 m Breite. Die Halle als Hypostyl gebaut konnte durch zwei Haupt- und zwei Seiteneingänge betreten werden und war über 16 m hoch. Der nordöstliche Seiteneingang beherbergt das Relief mit der geflügelten Figur, deren Blick ins Innere des Tors gerichtet ist. Man vermutet, dass die anderen Eingänge innen und außen ebenso mit Reliefs geschmückt waren. Acht quadratische Säulensockel mit einer Seitenlänge von 2 m und einer Höhe von mindestens 20 cm zeigen die Position der Säulen an. Der Durchmesser der untersten Säulentrommel könnte 1,25 m Durchmesser betragen haben.[10]
Über der Figur auf dem Relief war ursprünglich die Inschrift CMa angebracht, die zwischen 1861 und 1874 mitsamt dem Stein spurlos verschwunden ist. Die Figur mit den vier Flügeln trägt die ägyptische Hemhem-Krone, die auf einer eng anliegenden gerippten Kappe angebracht ist. Die Kleidung besteht aus einem bodenlangen Fransengewand. Die Figur trägt keine Schuhe.[11]
Unter den verschiedenen architektonischen Einflüssen, die am Tor R sichtbar sind, liegen die deutlichsten einheimischen Spuren in der Gliederung. Hohe rechteckige Hallen mit zwei Säulenreihen finden sich bei Hasanlu 1000 bis 800 v. Chr. und bei den Medern im 7. Jahrhundert v. Chr. Die Besonderheit von Tor R ist seine Zusammenstellung von westlicher Bautechnik, Fundamenten, Steinpflaster, Sockeln, Säulen und Türrahmen, die alle das Material Stein verwenden. Diese bildeten eine enge Verbindung mit verputzten Lehmziegelmauern und einem teilweise aus Holz bestehenden Dach.[12]
Die geflügelte Figur hat ihren Ursprung im assyrischen Lamassu und im Besonderen im geflügelten magischen Wächter im Palast von Sargon II. in Khorsabad. Es wird vermutet, dass in Analogie zum Palast von Sargon II. die anderen Eingänge von Tor R mit Stier-Reliefs geschmückt waren. Die Haltung der Figur wiederum erinnert an die Basaltstele von Nabonid und die Kleidung wie auch die eng anliegende Kappe an die Darstellung des elamischen Prinzen am Ulai. Die Figur zeigt bemerkenswerte Parallelen mit den neubabylonischen, syrisch-phönizischen und elamischen Kulturen. Dabei handelt es sich nicht um eine einfache Übernahme, sondern es zeigt sich bereit die Ruhe und Eleganz der späteren achämenidischen Skulpturen.[13]
Geschichte
Pasargadae wurde von Kyros II. gegründet, vielleicht als Heerlager, und von seinem Nachfolger Kambyses II. zwischen 559 v. Chr. und etwa 525 v. Chr. ausgebaut. Die Stadt erstreckte sich über ca. 300 Hektar.[14] Die Stadt verfügte seinerzeit über ein ausgeklügeltes unterirdisches Bewässerungssystem.
Heute sind die Ruinen der Paläste mit Monumentaltoren, Apadana und dem Empfangspalast mit reichem plastischem Schmuck zu sehen. Im heiligen Bezirk liegt ein Feuertempel mit Altären und das Grabmal König Kyros’ II. Auf einen Sockel aus sechs Steinstufen ist ein Kenotaph in der Form eines kleinen Steinhauses aufgesetzt. Das Grabmal stand in einem weitläufigen Garten.[15] Um 520 v. Chr. wurde die Residenz von Dareios I. etwa 50 km nach Südwesten verlegt. Die rekonstruierten Reste der Hauptstadt sind unter dem griechischen Namen Persepolis bekannt.
Eine dritte Residenz des Perserreiches lag in Susa, unweit der heutigen Großstadt Abadan nahe der irakischen Grenze. Die drei in unterschiedlichem Maße zerstörten Orte waren einst von Wohnvierteln umgeben. Weitere Residenzen waren die alte Mederhauptstadt Ekbatana und zuweilen auch Babylon.
Entdeckungsgeschichte und Archäologie
Der erste Europäer, der Pasargadae besuchte, war wahrscheinlich Giosafat Barbaro 1474. Von ihm ist überliefert, dass das Grab von Kyros II. unter dem Namen „Das Grab der Mutter von Salomo“ bekannt war. 1638 beschrieb Johann Albrecht von Mandelslo das Grab als „kleine Kapelle aus weissem Marmor, die über ein treppenförmiges Mauerwerk“ erreichbar war. Ihm erzählten Karmeliten aus Schiras, dass es sich um „die Grabstätte der Mutter von Schah Sulaiman, dem vierzehnten Kalifen“ handelte. 1672 berichtete der Holländer John Struys, dass das Grab in der Murghab-Ebene zu einem Pilgerort von Frauen geworden war. 1706 bezweifelte Cornelis de Bruyn als erster die Zuweisung des Grabes an die Mutter von Salomo, da dieser doch selbst das „Heilige Land“ nie verlassen habe und es daher unwahrscheinlich sei, dass er seine Mutter außerhalb des Landes begraben ließ.[16]
Im 19. Jahrhundert häuften sich die Berichte, von denen die wichtigsten im Folgenden aufgeführt sind. James Morier berichtete 1812 erstmals über Einzelheiten der Ruinen von Pasargadae. Ihm folgten 1820 Georg Friedrich Grotefend, 1821 William Ouseley, 1821 Robert Ker Porter, 1839 Claudius James Rich, 1852 Charles Texier, 1851–1854 Eugène Flandin und Pascal Coste. Die ersten Photographien erstellte Franz Stolze 1882. Einer der letzten Besucher im 19. Jahrhundert waren George Curzon und der französische Archäologe Marcel-Auguste Dieulafoy.[17]
Im Jahr 1907 wurde der deutsche Archäologe Ernst Herzfeld (1879–1948) an der Universität Berlin mit einer Dissertation Pasargadae. Aufnahmen und Untersuchungen zur Persischen Archäologie bei Eduard Meyer promoviert. Herzfeld hatte die Ruinen von Pasargadae 1905 erstmals besucht. Die ersten systematischen Ausgrabungen erfolgten im Jahr 1928 durch Herzfeld und seinen Assistenten Friedrich Krefter mit finanzieller Unterstützung der Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft.[18]
Später wurde Pasargadae von iranischen und 1961 bis 1963 unter David Stronach auch von britischen Archäologen erforscht. Ein bedeutender Teil der ersten Grabungsdokumentationen und Fragmente von Wandmalereien aus Pasargadae befinden sich heute im Ernst Herzfeld Nachlass in der Freer Gallery of Art in Washington, DC.[19]
Gärten
David Stronach identifizierte die Gärten der Kyros-Residenz.[20] Sie waren von Säulenhallen umgeben. Es ist nicht sicher, ob sich hier andere feste Gebäude befanden oder ob der König in einem Heerlager residierte.[21]
Steingefaßte Kanäle definierten zwei aneinander angrenzende Gärten. Die Kanäle folgen vermutlich einem natürlichen Flussbett und wurden vielleicht genutzt, um das Baumaterial zu transportieren.[22] Stronach rekonstruierte einen Tschāhār Bāgh von 145 × 112,5 m Fläche. Seine Grenzen wurden durch kleinere Kanäle definiert, die zu der Querwand des Palastes im Norden und einem kleinen Pavillon im Süden führten. Stronach nahm an, dass der Thron des Kyros in der Achse eines der Gärten stand. Weitere Kanäle wurden im Zuge eines geomagnetischen Surveys durch ein Team der Iranian Cultural Heritage Organisation des Ministeriums für Forschung und des Ministeriums für Denkmalpflege und des französischen Maison de l'Orient der Universität von Lyon und des CNRS entdeckt.
Der Pavillon hatte eine steinerne rechteckige Basis, die 11,5 × 10,2 m maß. Im Nordosten und Südwesten besaß das Bauwerk jeweils einen Portikus, 17 m lang und 4,3 m breit, der über das Gebäude hinausragte.[23] Von dem Gebäude selbst haben sich nur wenige Reste erhalten.
Eine steinerne Brücke führte über einen der Hauptkanäle.[24] Sie war 15,6 m lang und 16 m breit und mit drei Säulenreihen versehen, die in ca. 4 m Abstand errichtet waren und einen Durchmesser von ca. 90 cm hatten. Sie waren ursprünglich ca. 2 m hoch und besaßen kein Kapitell.
Rezeption
Thomas Browne publizierte 1658 einen Essay über The Garden of Cyrus, or the quincuncial, lozenge, or network plantations of the ancients, artificially, naturally, mystically considered. Er beschäftigte sich vor allem mit dem Quincunx, die Anordnung von Bäumen in einem Karo-Muster, das er mit dem griechischen Kreuz verglich und mit der Kreuzigung Christi verband. Browne betont die Bedeutung klarer Ordnung in der Gartenkunst. Kyros habe Bäume wie seine Armeen angeordnet (“Disposing his trees like his armies in regular ordination”).[25]
Literatur
- Ernst Herzfeld: Pasargadae. Aufnahmen und Untersuchungen zur persischen Archäologie. In: Klio. Bd. 8, 1908, S. 1–68.
- Ernst Herzfeld: Bericht über die Ausgrabungen von Pasargadae 1928. In: Archäologische Mitteilungen aus Iran. Bd. 1, 1929, ISSN 0066-6033, S. 4–16.
- Carl Nylander: Ionians in Pasargadae: Studies in Old Persian Architecture (=Uppsala Studies in Ancient Mediterranean and Near Eastern Civilizations. Band 1) Stockholm 1970.
- David Stronach: Pasargadae. A report on the excavations conducted by the British Institute of Persian Studies from 1961 to 1963. Clarendon Press, Oxford 1978, ISBN 0-19-813190-9.
- Peter Calmeyer: Figürliche Fragmente aus Pasargadae nach Zeichnungen E. Herzfelds. In: Archäologische Mitteilungen aus Iran. Bd. 14, 1981, S. 27–44.
- David Stronach: Ernst Herzfeld and Pasargadae. In: Ann C. Gunter, Stefan R. Hauser (Hrsg.): Ernst Herzfeld and the Development of Near Eastern Studies. 1900–1950. Brill, Leiden u. a. 2005, ISBN 90-04-14153-7, S. 103–136.
- David Stronach, Hilary Gopnik: Pasargadae. In: Encyclopædia Iranica, 20. Juli 2009
- Ali Mozaffari (Hrsg.): World Heritage in Iran: Perspectives on Pasargadae. Ashgate Publishing, 2014, ISBN 978-1-4094-4844-0.
Weblinks
- Eintrag auf der Website des Welterbezentrums der UNESCO (englisch und französisch).
- Ernst Herzfeld Persepolis Archiv. Freer Gallery of Art, Washington DC
Einzelnachweise
- Stronach 1978, S. 11–12.
- Stronach 1978, S. 13.
- Stronach 1978, S. 11.
- Stronach 1978, S. 13–15.
- Stronach 1978, S. 15.
- Stronach 1978, S. 21–22.
- Stronach 1978, S. 22–23.
- Stronach 1978, S. 26–27. Zum Grabmal siehe auch Kyros II.#Grabmal
- Stronach 1978, S. 39–43.
- Stronach 1978, S. 44–47.
- Stronach 1978, S. 47–50.
- Stronach 1978, S. 50–51.
- Stronach 1978, S. 51–52.
- Rémy Boucharlat: Pasargadae. In: Iran Bd. 40, 2002, S. 279, JSTOR 4300633.
- David Stronach: Excavations at Pasargadae: Third Preliminary Report. In: Iran. Bd. 3, 1965, S. 16.
- Stronach 1978, S. 1–2.
- Stronach 1978, S. 2–5. Die Jahreszahlen beziehen sich auf die Veröffentlichungen und nicht auf die zuvor unternommenen Reisen.
- Dipl. Ing. Friedrich Krefter bei GEPRIS Historisch. Deutsche Forschungsgemeinschaft, abgerufen am 10. Juni 2021.
- Herzfeld Resource Gateway. Freer Gallery of Art and Arthur M. Sackler Gallery Archives, abgerufen am 22. Oktober 2018.
- David Stronach: Pasargadae, a report on the excavations conducted by the British Institute of Persian Studies from 1961 to 1963. Clarendon Press, Oxford 1978.
- Rémy Boucharlat: Pasargadae, 2002, S. 279–280.
- David Stronach: Excavations at Pasargadae: Third Preliminary Report, 1965, S. 30.
- David Stronach: Excavations at Pasargadae: Third Preliminary Report, 1965, S. 31.
- David Stronach: Excavations at Pasargadae: Third Preliminary Report, 1965, S. 29.
- Susan Stewart: Garden Agon. In: Representations Bd. 62, 1998, S. 134.