Esslinger Triebwagen
Der Esslinger Triebwagen ist ein im Jahr 1951 erstmals ausgelieferter Dieseltriebwagen für nichtbundeseigene Eisenbahnen.
| Esslinger Triebwagen, 1. Serie | |
|---|---|
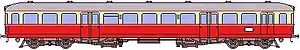 Zeichnung Esslinger Triebwagen (Erste Serie 1951–1957) Zeichnung Esslinger Triebwagen (Erste Serie 1951–1957) | |
| Anzahl: | 25 Triebwagen 4 Beiwagen 6 Steuerwagen |
| Hersteller: | Maschinenfabrik Esslingen |
| Baujahr(e): | 1951–1957 |
| Achsformel: | (1A)(A1) (16 Exempl.) B’2’ (7 Exempl.) B’B’ (2 Exempl.) |
| Spurweite: | 1435 mm (Normalspur) |
| Länge über Puffer: | 23.530 mm |
| Höhe: | 3913 mm |
| Breite: | 2930 mm |
| Drehzapfenabstand: | 15.800 mm |
| Drehgestellachsstand: | 2500 mm; Treibdrehgestell: 3600 mm * |
| Leermasse: | 32,0 t – 38,0 t |
| Höchstgeschwindigkeit: | 80 km/h |
| Installierte Leistung: | 2×145 PS 2×150 PS |
| Motorentyp: | Deutz A8L614, A12L714 MAN W6V15/18A |
| Sitzplätze: | 71–112 |
| Fußbodenhöhe: | 1240 mm; 1200 mm * |
| Klassen: | 3. Klasse, (ab 1956 2. Klasse), z. T. auch 2. Klasse (ab 1956 1. Klasse) |
| * Bentheimer Eisenbahn VT1–VT3 | |
| Esslinger Triebwagen, 2. Serie | |
|---|---|
| Anzahl: | 6 Triebwagen 4 Beiwagen 5 Steuerwagen |
| Hersteller: | Maschinenfabrik Esslingen |
| Baujahr(e): | 1958–1961 |
| Achsformel: | B’B’ |
| Länge über Puffer: | 25.030 mm |
| Höhe: | 3700 mm |
| Breite: | 2870 mm |
| Drehzapfenabstand: | 17.300 mm |
| Drehgestellachsstand: | 2.500 mm |
| Leermasse: | 37,5 t |
| Höchstgeschwindigkeit: | 85 km/h |
| Installierte Leistung: | 2×190 PS 2×220 PS |
| Motorentyp: | Deutz A12L714 Deutz BA12L714, F8L413 |
| Sitzplätze: | 84–98 |
| Fußbodenhöhe: | 1200 mm |
| Klassen: | 2. Klasse, z. T. auch 1. Klasse |
| (alle weiteren Daten siehe obige Infobox) | |
Geschichte
Der Esslinger Triebwagen, kurz „Esslinger“, wurde Anfang der 1950er Jahre von der Maschinenfabrik Esslingen für Klein- und Privatbahnen entwickelt. In zwei Bauserien entstanden insgesamt 31 Triebwagen (VT), hinzu kamen acht Beiwagen (VB) und elf Steuerwagen (VS).
Die erste Serie wurde von 1951 bis 1957 gebaut. Diese Fahrzeuge hatten die Fensterteilung 3–5–3, bis 1954 drei Stirnfenster und wirkten insgesamt etwas runder. Die zweite Serie wurde ab 1958 gefertigt. Deren Fahrzeuge waren 1,5 Meter länger, die Fensterteilung war 4–4–4. Neben den zwei Stirnfenstern hatten sie auch je ein Fenster in der Ecke und eine tiefere Schürze.
Von der ersten Bauserie wurden 25 Triebwagen, sechs Beiwagen und vier Steuerwagen dem Betrieb übergeben, von der zweiten Bauserie sechs Triebwagen, vier Beiwagen und fünf Steuerwagen.
Insgesamt wurden achtzehn verschiedene Bahnbetriebe mit Triebwagen beliefert. Durch die Einstellung vor allem norddeutscher Bahnen kamen die meisten der Fahrzeuge nach Süddeutschland.
| Hergestellte Einheiten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Triebwagen | Beiwagen | Steuerwagen | ||||
| Bahngesellschaft | 1. S. | 2. S. | 1. S. | 2. S. | 1. S. | 2. S. |
| Farge-Vegesacker Eisenbahn | 2 | 1 | ||||
| Württembergische Eisenbahn-Gesellschaft | 2 | |||||
| Altona-Kaltenkirchen-Neumünster | 3 * | 2 | ||||
| Kleinbahn Bielstein–Waldbröl | 1 | |||||
| Bergedorf-Geesthachter Eisenbahn | 2 * | |||||
| Bentheimer Eisenbahn | 3 * | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| Rinteln-Stadthagener Eisenbahn | 1 | |||||
| Teutoburger Wald-Eisenbahn | 1 | |||||
| Moselbahn | 3 | |||||
| Deutsche Eisenbahn-Betriebsgesellschaft | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
| Hildesheim-Peiner Kreis-Eisenbahn-Gesellschaft | 1 | |||||
| Butzbach-Licher Eisenbahn | 1 | |||||
| Kahlgrund Verkehrs-GmbH | 1 | |||||
| Kleinbahn Neheim-Hüsten–Sundern | 1 | |||||
| Kleinbahn Niebüll–Dagebüll | 1 | |||||
| Kleinbahn Kiel–Segeberg | 1 | |||||
| Kiel-Schönberger Eisenbahn | 1 | 1 | ||||
| Frankfurt-Königsteiner Eisenbahn | 4 | 4 | ||||
| Summe | 25 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 |
| * = einmotorig | ||||||
| Bezeichnung(en) | Fabriknummer | Serie | Baujahr | Bahngesellschaften | Motoren | Achsfolge | Erhalten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T21 FVE
VT21 TWE |
23341 | 1 | 1951 | 1951–1962: FVE
1962–1975: TWE |
1951: 2× MAN 150 PS
1962: 2× KHD 220 PS 19??: 2× Büssing 150 PS |
(1A)(A1) | Nein | |
| T20 FVE
VT20 TWE |
23342 | 1 | 1951 | 1951–1962: FVE
1962–1973: TWE |
1951: 2× MAN 150 PS
1962: 2× KHD 220 PS 19??: 2× Büssing 150 PS |
(1A)(A1) | Nein | |
| T10 WN
VT402 WEG VT402 ESG T10 SDN |
23343 | 1 | 1951 | 1951: WN
1985: WEG 2000: ESG 2007: SDN 20??: Igeba |
1951: 2× MAN 150 PS
1968: 2× Büssing 210 PS |
(1A)(A1) | Fahrzeug seit 2000 abgestellt | Ja (Stand 2015) |
| VT6 AKN
VT111 SWEG VB236 WEG |
23349 | 1 | 1951 | 1951: AKN
1964: SWEG 2000: RHEB 2009: DBK |
1951: 1× MAN 300 PS
1981: Ohne Motor |
B’2’
1981: 2’2’ |
1981 Umbau zum Beiwagen | Ja (Stand 2012) |
| VT7 AKN
VT26 TAG VT90 FKE VT03 RAG/RBG 05 BBG DTW01 CLR |
23350 | 1 | 1951 | 1951–1963: AKN
1963–1966: TAG 1966–1977: FKE 1977–2001: RAG 2001–2005: BBG 2005–2017: Privat 2017– |
1951: 1× MAN 300 PS
1993: 1× Caterpillar 306 PS |
B’2’
1981: 2’2’ 1993: B’2’ |
Ja (Stand 2017) | |
| VS160 FVE
VS 60 TWE VB160 TWE VB06 LLK VB26 RBG VS26 RBG |
23371 | 1 | 1951 | 1951–1959: FVE
1959–1969: TWE 1969–1973: LLK 1973–1994 |
2’2’ | Zwischenzeit nur Beiwagen;
1987 abgestellt |
Nein | |
| T33 OVAG
GDT0519 OHE |
23372 | 1 | 1951 | 1951–1957: OVAG
1957–1978: OHE |
2× MAN 150 PS | (1A)(A1) | Nein | |
| T3 BGE
VT9 AKN VT04 RBG VT3 GE |
23384 | 1 | 1951 | 1951–1955: BGE
1955–1963: AKN 1963–1986: RBG 1986–2005: GE |
1× MAN 300 PS | B’2’ | Nein | |
| T4 BGE
VT10 AKN VT110 SWEG VT110 DEW VT110 KML |
23385 | 1 | 1951 | 1951–1955: BGE
1955–1963: AKN 1963–1985: SWEG 1985–2000: DEW 2000–?: KML |
1× MAN 300 PS | B’2’ | ? | |
| VT1 BE
VT91 FKE VT07 RAG/RBG |
23436 | 1 | 1952 | 1952–1972: BE
1972–1977: FKE 1977–Jetzt: RAG/RBG |
1× DB 400 PS | B’2’ | Museumsfahrzeug | Ja (Stand 2019) |
| VT2 BE
VT05 LLK VT05 RAG/RBG |
23437 | 1 | 1952 | 1952–1970: BE
1970–1973: LLK 1973–Jetzt: RAG/RBG |
1× DB 400 PS | B’2’ | Ja (Stand 2013) | |
| VT3 BE
VT10 HzL VT06 LLK VT06 RAG/RBG |
23438 | 1 | 1952 | 1952–1971: BE
1971–1973: HZL 1973: LLK 1973–2001: RAG/RBG |
1× DB 400 PS | B’2’ | Nein | |
| VB22 BE
VB22 FKE VB167 KVG |
23439 | 1 | 1952 | 1952–1972: BE
1972–1974: FKE 1974–1995: KVG 1995–?: Pfalzbahn |
- | 2’2’ | ? | |
| VB21 BE
VS21 BE VS21 HzL VS01 LLK VS11 RBG VM11 RBG VM11 BBG |
23440 | 1 | 1952 | 1952–1971: BE
1971–1973: HZL 1973: LLK 1973–2001: RBG 2001–2005: BBG 2005–?: Privat |
2’2’ | 1957 Umbau zu VS;
1992 Rückbau zu VM |
? | |
| VB23 BE | 23441 | 1 | 1952 | 1952–1974: BE
1974–1993: Italien 1993–??: Italien |
2’2’ | 1974 Verkauf nach Italien | ? | |
| T20 WEG
VT403 WEG VT403 Brücke e.V. |
23493 | 1 | 1952 | 1952–1999 WEG
1999–2002: Brücke e.V. |
2× Büssing 150 PS
2× Büssing 180 PS 2× Büssing 210 PS |
(1A)(A1) | Nein | |
| VT61 RStE
VT3 HzL VT3 EFZ VT3 WTB |
23494 | 1 | 1952 | 1952–1965: RSTE
1965: TWE 1965–1968: RSTE 1968–1993: HZL 1993–1994: EFZ 1994–2015: WTB 2015–Jetzt: HEM[1] |
2× KHD 145 PS
2× KHD 155 PS |
(1A)(A1) | Ja (Stand 2022) | |
| VT60 TWE | 23495 | 1 | 1952 | 1952–1969: TWE | 2× KHD 145 PS | (1A)(A1) | 1966 nach Unfall abgestellt | Nein |
| T64 MB
VT114 SWEG VT114 ESG VT114 WEG |
23497 | 1 | 1952 | 1952–1969: MB
1969–1998: SWEG 1998–2004: ESG |
2× KHD 145 PS | (1A)(A1) | 1998–2000: an WEG vermietet
1999 nach Unfall abgestellt |
|
| VT104 DEBG
VT104 SWEG VT104 VBK VT104 DBK |
23498 | 1 | 1952 | 1952–1963: DEBG
1963–2000: SWEG 2000–2009: VBK 2009–Jetzt: DBK |
2× KHD 145 PS
2× KHD 190 PS |
(1A)(A1) | In Aufarbeitung (Stand 2019) | Ja (Stand 2019) |
| VT103 DEBG
VT103 SWEG VT103 FFF VT103 CLB |
23499 | 1 | 1952 | 1952–1963: DEBG
1963–1994: SWEG 1994–2005: FFF 2005–Jetzt: CLB |
2× KHD 145 PS | (1A)(A1) | Ja (Stand 2017) | |
| VT102 DEBG
VT102 SWEG |
23500 | 1 | 1952 | 1952–1963: DEBG
1963–1998: SWEG |
2× KHD 145 PS | (1A)(A1) | 1992 abgestellt | Nein |
| VT62 HPKE
T62 TWE VS230 WEG T62 VBV |
23504 | 1 | 1952 | 1952–1967: HPKE
1967–1986: TWE 1986–1999: WEG 1999–2015: Brücke e.V. 2015–Jetzt: VBV |
2× KHD 145 PS
-Ohne- 1× Büssing 210 PS aus VT403? |
(1A)(A1)
2’2’ (1A)(2) ? |
1986–1989 Umbau in Steuerwagen;
2004 Rückbau in Triebwagen |
Ja (Stand 2020) |
| T63 MB
VT113 SWEG |
23550 | 1 | 1952 | 1952–1969: HPKE
1969–1976: SWEG |
2× KHD 145 PS | (1A)(A1) | Nach Unfall verschrottet | Nein |
| VT8 AKN
VT109 DEBG VT109 SWEG VB238 SWEG VB239 ESG |
23778 | 1 | 1955 | 1955–1961 AKN
1961–1963 DEBG 1963–1999 SWEG 1999–200? ESG 200? IGEBA |
(1A)(A1)
2’2’ |
1983: Umbau in Beiwagen | Ja | |
| VS1 AKN
VS1 TAG VS166 FKE VB166 KVG VS240 WEG VS240 DBK VS240 ESG |
23779 | 1 | 1955 | 1955–1963 AKN
1963–1967 TAG 1967–1974 FKE 1974–1988 KVG 1988–2004 WEG 2004 DBK 2004 ESG |
ohne | 2’2’ | 1974: Ausbau Steuerstand
1993 Wiedereinbau Steuerstand |
Ja |
| VS2 AKN
VS225 SWEG VB225 ESG |
23780 | 1 | 1955 | 1955–1963 AKN
1963–1999 SWEG 1999 ESG |
ohne | 2’2’ | 1981: Umbau in Beiwagen | Ja |
| Zweite Serie | ||||||||
| VT4 BE
VT112 SWEG |
25058 | 2 | 1958 | 1958–1965 BE
1965–?? SWEG |
B’B’ | |||
| VB25 BE | 25059 | 2 | 1958 | 1958–1975 BE
1975 Italien |
ohne | 2’2’ | ||
| VB26 BE | 25620 | 2 | 1960 | 1960–1974 BE
1974 Italien |
ohne | 2’2’ | ||
Konstruktive Merkmale
Die Fahrzeuge wiesen herkömmliche Zug- und Stoßeinrichtungen (Kupplungen und Puffer) auf, gegebenenfalls konnten die Triebwagen wie Schlepptriebwagen auch Güterwagen mitführen.[2] Die Wagenkästen waren aus Profilen und Blechen geschweißt.
Zwischen den Abteilen waren jeweils zwei Doppeltüren angebracht, wobei der Anschlag meist mittig des Einstieges war, nicht an den Außenseiten. Einige Triebwagen hatten an einem Ende hinter dem Führerstand auch ein Gepäckabteil mit separater Doppeltür. Die Fahrzeuge der Bentheimer Eisenbahn der ersten Serie hatten Stirntüren mit einem Übergangsblech, diese wurden Ende der 1950er Jahre zugesetzt, und später durch ein schmales mittleres Stirnfenster ersetzt. Dafür hatten diese Triebwagen am ersten Einstieg hinter dem Führerraum nur eine einfache Tür. Die anderen Triebwagen hatten drei gleichgroße Stirnfenster, ab 1954 zwei Stirnfenster. Die Führerräume waren durch eine Zwischenwand von den Abteilen abgetrennt, die im oberen Teil verglast war. Einige Triebwagen hatten eine Toilette. In der Regel waren die Fenster als Senkfenster mit Metallrahmen ausgeführt. Die ersten Fahrzeuge wurden teilweise auch mit Holzlattenbänken ausgeliefert, später waren gepolsterte Sitze die Regel. Die Sitzteilung war 2+2 in der ersten und 3+2 in der 2. Klasse.
Die meisten Fahrzeuge waren zweimotorig, die jeweils innere Achse des Drehgestells wurde über Flüssigkeitskupplung, Getriebe und Wendegetriebe angetrieben. Bei zwei Triebwagen der ersten Serie und allen Triebwagen der zweiten Serie wurden alle Achsen angetrieben.
Sieben Triebwagen waren einmotorig, der Motor wirkte über Gelenkwellen und ein Voith-Getriebe auf beide Achsen des einen Drehgestells. Während die Motoren normalerweise unterflur angebracht waren, war der Motor bei den einmotorigen Triebwagen der Bentheimer Eisenbahn auf dem Drehgestell aufgebaut, das daher verstärkt war und einen Radstand von 3,6 Metern aufwies; der Motor ragte in den Fahrgastraum hinein.
Die Triebwagen der Bentheimer Eisenbahn verfügten auch über einen ölgefeuerten Heizkessel für die Zugheizung, der im Gepäckraum untergebracht war So konnten normale Personenwagen (u. a. Kurswagen der DB) mitgeführt werden.
Die meisten Triebwagen waren bei Auslieferung creme-rot lackiert, es gab aber auch Triebwagen in Creme-Blau. Die Triebwagen der ersten Serie hatten bei Auslieferung auch eine umlaufende Leiste unter den Fenstern. Später wurden die Triebwagen in den jeweiligen Bahnfarben lackiert.
Betriebsfähige Exemplare
Zehn Esslinger Triebwagen sind noch erhalten, außerdem zwei Beiwagen und zwei Steuerwagen:
Ein Triebwagen der ersten Serie (ehemals Kleinbahn Niebüll–Dagebüll) sowie ein Beiwagen (ehemals Deutsche Eisenbahn-Betriebsgesellschaft) wird beim Deutschen Eisenbahn-Verein eingesetzt.
Die Kreisbahn Mansfelder Land setzt einen modernisierten Esslinger Triebwagen (der zweiten Serie) im Gelegenheitsverkehr auf der Wipperliese ein.
Die als Museumsbahn betriebene Lokalbahn Endorf–Obing (LEO) setzte im Sommerhalbjahr bis 2014 regelmäßig an allen Sonn- und Feiertagen den VT 103 (erste Serie) ein, er ist wegen abgelaufener Hauptuntersuchung abgestellt (2018), wird aber wieder aufgebaut.
Die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft setzte ein Fahrzeug der zweiten Serie auf dem Felsenlandexpress zwischen Karlsruhe und Bundenthal-Rumbach ein.[3][4] Derzeit ist allerdings fraglich, ob der im August 2017 aufgetretene Motorschaden repariert wird. Vorläufig ist das Fahrzeug deshalb abgestellt.[5]
Außerdem hat die Regentalbahn AG noch zwei Fahrzeuge der ersten Serie (VT + VS) im Bestand, mit denen der Verein Wanderbahn im Regental Ausflugsfahrten auf der Bahnstrecke Gotteszell–Viechtach anbietet. Aufgrund der Aufnahme des regulären Betriebs auf dieser Strecke verkehren diese Züge seit 2017 in gemischter Traktion mit einem Regio-Shuttle.
Der ehemalige VT 61 der Rinteln-Stadthagener Eisenbahn wird bei der Historischen Eisenbahn Mannheim wieder aufgearbeitet, nachdem er bis 2015 bei der Wutachtalbahn im Einsatz und zuletzt abgestellt war.
Bildergalerie
- Esslinger verschiedener Unternehmen
 VT 61 der RStE in Nienstädt (1964)
VT 61 der RStE in Nienstädt (1964) VT 103 der SWEG im Bahnhof Odenheim (1990)
VT 103 der SWEG im Bahnhof Odenheim (1990) VT 103 der Lokalbahn Endorf–Obing in Halfing (2007)
VT 103 der Lokalbahn Endorf–Obing in Halfing (2007) VT 114 der SWEG im Bahnhof Menzingen (1989)
VT 114 der SWEG im Bahnhof Menzingen (1989) VT 112 der SWEG im Bahnhof Münzesheim (1992)
VT 112 der SWEG im Bahnhof Münzesheim (1992) VT 452 der AVG auf der Murgtalbahn (2002)
VT 452 der AVG auf der Murgtalbahn (2002).jpg.webp) Esslinger Triebwagen der Frankfurt-Königsteiner Eisenbahn in Kelkheim (1984)
Esslinger Triebwagen der Frankfurt-Königsteiner Eisenbahn in Kelkheim (1984)
Literatur
- Thomas Estler: Esslinger Triebwagen. Transpress Verlag, Stuttgart 2002, ISBN 3-613-71182-6.
- Michael Kochems: 55 Jahre „Esslinger“. In: Eisenbahn-Magazin, 12/2001, S. 28–32.
- Wolfgang Fiegenbaum: Die Triebwagen der Maschinenfabrik Eßlingen bei den deutschen Privatbahnen. In: Lok Magazin, 114/1982, S. 199–217 und Lok Magazin, 115/1982, S. 286–294.
- Rolf Löttgers: Benz ohne Stern in Niedersachsen. In: eisenbahn-magazin. Nr. 11, 2018, ISSN 0342-1902, S. 46–49.
Weblinks
Einzelnachweise
- Esslinger VT61 - Historische Eisenbahn Mannheim. Abgerufen am 1. Februar 2022.
- Auf der TWE in: Lok Magazin 11/2015, S. 76 f.
- Dieseltriebwagen 452 der Maschinenfabrik Esslingen auf der AVG-Webseite
- Private Webseite mit einigen Außen- und Innenaufnahmen einer solchen Fahrt vom 19. Juli 2014 und ein Video aus 2017
- Felsenland-Express wird ab sofort von DB Regio gefahren (Memento vom 15. September 2017 im Internet Archive)