Der Rhein (Hölderlin)
Der Rhein ist eine Hymne von Friedrich Hölderlin. Sie zählt zu seinen „Vaterländischen Gesängen“ und ist unter diesen einer der bekanntesten.[1] Der Begriff „Vaterländische Gesänge“ geht auf einen Brief Hölderlins an den Frankfurter Verleger Friedrich Wilmans vom Dezember 1803 zurück, in dem er von der Durchsicht „einiger Nachtgesänge“ berichtet und fortfährt:[2] „Übrigens sind Liebeslieder immer müder Flug <...>; ein anders ist das hohe und reine Frohloken vaterländischer Gesänge.“ Schon kurz zuvor hatte er Wilmans „einzelne größere lyrische Gedichte“ angekündigt, „so daß jedes besonders gedrukt wird weil der Inhalt unmittelbar das Vaterland angehn soll oder die Zeit“.[3]

Entstehung und Überlieferung
Von Anfang Januar 1796 bis Ende September 1798 war Hölderlin Hofmeister, Hauslehrer, für den Sohn des Kaufmanns Jakob Friedrich Gontard-Borkenstein (1764–1843) und dessen Frau Susette in Frankfurt am Main. Susette wurde Hölderlins Diotima. Nach dem Bruch mit Gontard lebte Hölderlin zunächst im nahen Homburg, ab Mitte Juni 1800 in Nürtingen, wo Mutter und Schwester wohnten, und Stuttgart. Von Januar bis April 1801 war er Hofmeister bei dem Leinenfabrikanten Anton von Gonzenbach (1748–1819) in Hauptwil in der Schweiz. Dort hat er das Gedicht Der Rhein konzipiert, hat es aber wohl erst im Sommer 1801, zurück in Nürtingen, fertiggestellt, bevor er im Dezember zu einer weiteren Hofmeisterstelle – seiner letzten – in Bordeaux aufbrach.
Drei Autographen sind überliefert. Ein Einzelblatt (zwei beschriebene Seiten), das in der Württembergischen Landesbibliothek in Stuttgart aufbewahrt wird und über sie elektronisch verfügbar ist,[4] „H1“ nach der von Friedrich Beissner, Adolf Beck und Ute Oelmann (* 1949) herausgegebenen historisch-kritischen Stuttgarter Ausgabe der Werke Hölderlins,[5] enthält einen Entwurf der Verse 1–31 und 105–122. Zwei Blätter (vier beschriebene Seiten), „H2“ nach der Stuttgarter Ausgabe, die im Deutschen Literaturarchiv Marbach aufbewahrt werden, enthalten die Verse 46–95 und 180–121. Fünf Blätter (zehn beschriebene Seiten), „H3“ nach der Stuttgarter Ausgabe, ebenfalls in der Württembergischen Landesbibliothek und über sie elektronisch verfügbar, enthalten das ganze Gedicht unmittelbar im Anschluss an die letzte Strophe des Gedichts Die Wanderung. In „H3“ hat Hölderlin nachträglich Änderungen eingetragen. Das Blatt „H1“ ist in das Konvolut „H3“ eingeklebt.
Gedruckt wurde Der Rhein erstmals 1808 im Musenalmanach für das Jahr 1808, herausgegeben von Leo Freiherrn von Seckendorf. Die Druckvorlage ist nicht erhalten; sie ist nicht identisch mit Hölderlins Reinschrift „H3“.[6]
 Vers 1–49
Vers 1–49 Vers 50–102
Vers 50–102 Vers 103–157
Vers 103–157 Vers 158–213
Vers 158–213 Vers 214–221
Vers 214–221
In diesem Artikel wird Hölderlin, wenn nicht anders angegeben, nach der Stuttgarter Ausgabe zitiert. Deren Herausgeber legten den Druck im Musenalmanach zugrunde, emendierten ihn aber vielfach unter Benutzung der Autographen mit dem Ziel, Hölderlins verlorene Druckvorlage wiederzugewinnen. So druckte der Musenalmanach Vers 68 „Im eigenen Zaume lachend,“, die Stuttgarter Ausgabe druckt gemäß „H3“ „Im eigenen Zahne, lachend“. Die „Leseausgaben“ von Jochen Schmidt und Michael Knaupp bieten wieder etwas andere Texte.
Der auffälligste Unterschied zwischen den Autographen und dem Erstdruck betrifft die Widmung. Sie fehlt in „H1“ und „H2“, lautet „An Vater Heinze“ – gemeint ist der vierundzwanzig Jahre ältere Wilhelm Heinse – in „H3“ und „An Isaak von Sinclair“ – den fünf Jahre jüngeren Isaac von Sinclair – im Musenalmanach. Man nimmt an, dass Hölderlin die Widmung änderte, nachdem Heinse am 22. Juni 1803 gestorben war. Die Umwidmung zog Änderungen in der zehnten, elften und fünfzehnten Strophe des Gedichts nach sich (siehe dort).
Einen Satz aus Heinses 1787 erschienenen Roman Ardinghello hatte Hölderlin 1791 als Motto über sein Gedicht Hymne an die Göttin der Harmonie gesetzt.[7] Er kannte auch Heinses 1795 bis 1796 erschienenen dreibändigen Musikroman Hildegard von Hohenthal. Im Juli 1796 stieß Heinse zu Susette Gontard, Susettes Kindern und Hölderlin, als sie vor den im Ersten Koalitionskrieg heranziehenden französischen Truppen von Frankfurt nach Kassel und Bad Driburg geflohen waren. Bis Ende September 1796 konnte Hölderlin Heinse täglich sehen und sprechen. Heinse hat Hölderlin in seinem Pantheismus bestärkt, dazu in seiner Begeisterung für den „Vater Aether“,[8] seiner Hoffnung auf eine neue Harmonie zwischen Göttern und Menschen und seinem Dichten in freien Rhythmen. Hölderlin hat ihm auch die Elegie Brod und Wein gewidmet.[9] In dem Hymnenentwurf Der Vatikan hat er ihn „mein ehrlich Meister“ genannt.[10] Heinse hat Hölderlins musiktheoretisches, poetologisches und vaterlandsbezogenes Denken erheblich beeinflusst.[11]
Hölderlin und Isaac von Sinclair hatten sich 1793 in Tübingen kennengelernt. Im März 1795 wurden sie in Jena Freunde. Sie trafen sich in Vorlesungen Johann Gottlieb Fichtes und bewohnten zeitweise gemeinsam ein Gartenhaus vor den Toren der Stadt. An seine Schwester schrieb Hölderlin 1797 von „Sinklär, einem ganz vorzüglichen jungen Manne, der mein Freund ist, im gründlichsten Sinne des Worts“.[12] Beide strebten eine demokratische Verfassung an, doch war Sinclair anders als Hölderlin kämpferisch, aktivistisch[13] und unterhielt direkte Verbindungen zu umsturzwilligen Kreisen. Ab 1796 stand er im Dienst des Landgrafen Friedrichs V. von Hessen-Homburg. Auf seinen Rat übersiedelte Hölderlin im September 1798, als er Frankfurt verlassen musste, nach Homburg. Ein weiteres Mal half Sinclair ihm nach der Rückkehr aus Bordeaux 1802. Im Januar 1803 überreichte Sinclair dem Landgrafen die Widmungshandschrift von Hölderlins Hymne Patmos / Dem Landgrafen von Homburg.[14] Mitte 1804 schließlich holte er Hölderlin nach Homburg, wo er ihm eine Anstellung als Hofbibliothekar verschaffte, die er selbst finanzierte. Ihre Beziehung endete 1806, einerseits wegen Hölderlins psychischer Krankheit, andererseits weil Sinclair durch die Mediatisierung der Landgrafschaft Hessen-Homburg seine Anstellung verloren hatte. Hölderlin hat ihm auch die um 1800 in zwei Fassungen entstandene Ode An Eduard gewidmet, deren erster Entwurf „Bundestreue. An Sinklair“ überschrieben ist.[15]
Text und Interpretation
Von Hölderlins Stromgedichten – Der Main, Der Nekar, Der Ister, Der gefesselte Strom – ist Der Rhein das größte. Es ist in einem freien Rhythmus komponiert und besteht aus fünfzehn Strophen zu je 14 bis 16 Versen, bis auf die letzte Strophe mit 12 Versen, die aber in ihrer ersten Fassung im Manuskript „H2“ ebenfalls 14 Verse umfasste. Den Strophen wird von der Forschung eine Struktur in fünf „Triaden“ zu je drei Strophen übergeordnet. Die Triadenform war Hölderlin von seiner Beschäftigung mit Pindar bekannt. Er legte sie zum Beispiel auch der Elegie Brod und Wein zugrunde.
Im Manuskript „H1“ hat Hölderlin dem Gedicht eine Bemerkung vorgeschaltet:[16] „Das Gesetz dieses Gesanges ist, daß die zwei ersten Partien der Form <nach> durch Progreß u Regreß entgegengesetzt, aber dem Stoff nach gleich, die 2 folgenden der Form nach gleich dem Stoff nach entgegengesetzt sind die letzte aber mit durchgängiger Metapher alles ausgleicht.“ Die Bemerkung wurde nicht in den Musenalmanach übernommen.
Deutungen haben Martin Heidegger in einer im Wintersemester 1934/1935 gehaltenen Vorlesung in Freiburg im Breisgau, Walter Hof (* 1911), Wolfgang Binder, Bernhard Böschenstein, Jochen Schmidt und Ulrich Gaier (* 1935) gegeben. Nicht selten widersprechen sich die Interpreten. So setzen die meisten die fünf „Partien“ von Hölderlins Vorbemerkung mit den fünf Triaden gleich, für Ulrich Gaier dagegen sind die fünf „Partien“ die Strophen „1 und 2“, „3 und 4“, „5“, „6“ und „7 bis 15“. Grundsätzlich wird angenommen, dass Der Rhein drei Bilder gelingenden Lebens und seiner Bedingungen entwirft: in den Strophen 1 bis 9 das Bild des Stromes, in den Strophen 10 bis 13 das Bild des im Einklang mit der Natur lebenden Dichters, im gedruckten Gedicht Jean-Jacques Rousseaus, und in den Strophen 14 bis 15 das Bild des Weisen, des Philosophen, im gedruckten Gedicht des Sokrates und Sinclairs. Hinter den Bildern stehen Hölderlins Pantheismus und seine Geschichtsphilosophie, nach der ein liebendes Miteinander der göttlichen All-Natur und der Menschen zuerst südöstlich von Mitteleuropa verwirklicht war, vor allem im antiken Griechenland, während die Gegenwart eine Zeit der Götterferne sei, und nach der schließlich im Abendland, vor allem in Deutschland, Hölderlin sagt gern in „Hesperien“,[17] ein neuer Göttertag kommen kann.

Der Rhein
An Isaak von Sinclair
Im dunkeln Efeu sass ich, an der Pforte
Des Waldes, eben da der goldene Mittag,
Den Quell besuchend, herunterkam
Von Treppen des Alpengebirgs,
5Das mir die göttlich gebaute,
Die Burg der Himmlischen heisst
Nach alter Meinung, wo aber
Geheim noch manches entschieden
Zu Menschen gelanget; von da
10Vernahm ich ohn Vermuhten
Ein Schicksal, denn noch kaum
War mir im warmen Schatten
Sich manches beredend, die Seele
Italia zugeschweift
15Und fern hin an die Küsten Morea’s.
Feierlich, in hohem Ton, hebt das Gedicht an. Der Dichter sitzt „Im dunkeln Efeu“, umgeben von einer Pflanze der Götter, von der es in Patmos heißt:[18] „Und Zeug unsterblichen Lebens / An unzugangbaren Wänden / Uralt der Epheu wächst“. Es ist die Stunde, da „der goldene Mittag / Den Quell besuchend, herunterkam“, traditionell die Zeit der Inspiration.[19] Die Alpen, die „göttlichgebaute, / Die Burg der Himmlischen“, erlebte Hölderlin wieder – er war schon 1791 in der Schweiz gewesen – in Hauptwil, von wo er im Februar 1801 an seine Schwester schrieb:[20] „Du würdest auch so betroffen, wie ich, vor diesen glänzenden, ewigen Gebirgen stehn, und wenn der Gott der Macht einen Thron hat auf der Erde, so ist es über diesen herrlichen Gipfeln.“ Seine Gedanken schweifen „Italia zu“ und „fern hin an die Küsten Moreas“, der Peloponnes. Nach Süden und Osten zu schweifen also die Gedanken, dahin, wo es in der Antike gab, was die abendländische, hesperische Menschheit wieder gewinnen muss: die Einheit der göttlichen gesehenen Natur und der Menschen. Die Einleitungsstrophe handelt noch nicht ausdrücklich vom Rhein. „Sie hält sich in verbergender Vieldeutigkeit“.[21] Da aber trifft den Dichter „ohn Vermuthen / Ein Schiksaal“, die Kernvision seines Gedichts; es ist das Schicksal des Rheins, des auf Erden gefangenen Göttersohnes.
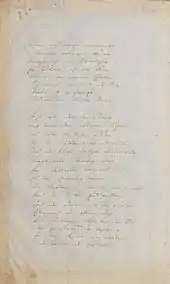
Jezt aber, drinn im Gebirg,
Tief unter den silbernen Gipeln,
Und unter fröhlichem Grün,
Wo die Wälder schauernd zu ihm,
20Und der Felsen Häupter übereinander
Hinabschaun, taglang, dort
Im kältesten Abgrund hört’
Ich um Erlösung jammern
Den Jüngling, es hörten ihn, wie er tobt’,
25Und die Mutter Erd’ anklagt’,
Und den Donnerer, der ihn gezeuget,
Erbarmend die Eltern, doch
Die Sterblichen flohn von dem Ort,
Denn furchtbar war, da lichtlos er
30In den Fesseln sich wälzte,
Das Rasen des Halbgotts.
Beim „Jezt“ der zweiten Strophe (Vers 16) hat der Standort gewechselt. Aus der Viamala sieht das „Ich“ über sich die göttlichen „silbernen Gipfel“ und das fröhliche Grün, das in Der Wanderer „das heilige Grün, der Zeuge des Seeligen, tiefen / Lebens der Welt“ heißt.[22] Unter sich aber hört es „im kältesten Abgrund“ „das Rasen des Halbgotts“, des immer noch ungenannten tosenden Stromes. Er ist Sohn der „Mutter Erd’“ (Vers 25) und des Donnerers Zeus, der zugleich wohl der Lichtgott ist, dessen „Lichtstral“ in Vers 52 „dem Neugebornen begegnet“. Wie der „Jüngling“ im ersten Teil der Strophe herausragt, so fasst das letzte Wort „Halbgott“ die Strophe überhaupt zusammen. Indem die Strophe vom Jüngling zum Halbgott fortschreitet, steigert sie sich entschieden ins Heroische.[23] Die Eltern hören den Strom „erbarmend“. Das Erbarmen des Vaters schildert die sechste Strophe.

Die Stimme wars des edelsten der Ströme,
Des freigeborenen Rheins,
Und anderes hoffte der, als droben von den Brüdern,
35Dem Tessin und dem Rhodanus,
Er schied, und wandern wollt’, und ungeduldig ihn
Nach Asia trieb die königliche Seele.
Doch unverständig ist
Das Wünschen vor dem Schicksal.
40Die Blindesten aber
Sind Göttersöhne. Denn es kennet der Mensch
Sein Haus und dem Thier ward, wo
Es bauen solle, doch jenen ist
Der Fehl, dass sie nicht wissen wohin?
45In die unerfahrne Seele gegeben.
Der Rhein wird zum ersten Mal genannt. Edel heißt er, freigeboren, ein Göttersohn (Vers 41) wie Herakles und Christus. Während sich „droben“ der Tessin nach Süden und der „Rhodanus“ (Vers 35), die Rhone, nach Westen wendet, treibt ihn „Nach Asia <...> die königliche Seele“. „Ihrer inneren Unendlichkeit entsprechend drängt es sie zum Unendlich-Göttlichen, für das bei Hölderlin immer wieder die östliche Ferne steht.“[24] In diesem „Wünschen“ ist sie aber „unverständig“, verkennt den göttlichen Willen, der bei Chur den Lauf des Rheins in die ihm bestimmte Richtung nach Norden biegen wird. „Die Blindesten“ sind die Göttersöhne, weil sie nicht wissen, was Vernunft und realistisches Handeln bedeuten. Sie haben es nicht gelernt, sich im Endlichen einzurichten.
Ein Räthsel ist Reinentsprungenes. Auch
Der Gesang kaum darf es enthüllen. Denn
Wie du anfiengst, wirst du bleiben,
So viel auch wirket die Not,
50Und die Zucht, das meiste nemlich
Vermag die Geburt,
Und der Lichtstral, der
Dem Neugebornen begegnet.
Wo aber ist einer,
55Um frei zu bleiben
Sein Leben lang, und des Herzens Wunsch
Allein zu erfüllen, so
Aus günstigen Höhn, wie der Rhein,
Und so aus heiligem Schoose
60Glüklich geboren, wie jener?
„Ein Räthsel ist Reinentsprungenes“ ist eine von Hölderlins bekanntesten Gnomen, knapp formulierten Einsichten, wie sie Pindar verwendete. „Reinentsprungen“ ist das Ursprüngliche, Unvermischte, Unsterbliche, Absolute.[25] Ihm gebühren religiöse Andacht und Ergriffenheit. Die Worte, menschliches Verstehen versagen vor ihm. Trotz „Noth“ und „Zucht“ Vers (49 und 50), Umweltdruck und Erziehung, prägt der Ursprung das Leben. Der Ursprung des Rheins wird noch einmal gerühmt. Wie nichts sonst ist er „Aus günstigen Höhn, <...> aus heiligem Schoose / Glüklich geboren“. Böschenstein weist darauf hin, dass „heilig“ nach „Gott“ wohl das meistbelegte Wort des späten Hölderlin ist, 143mal in den Gedichten nach 1800. „‚Heilig‘ ist das fruchtbare, bergende Dunkel um künftige Frucht, künftige Gestalt, künftiges Licht.“[26][27] „Um frei zu bleiben / Sein Leben lang, und des Herzens Wunsch / Allein zu erfüllen“ ist der Rhein geboren. Doch zur Erfüllung seines Daseins gehören die Lenkung durch den Vater und der Dienst an einem Ziel.

Drum ist ein Jauchzen sein Wort.
Nicht liebt er, wie andere Kinder
In Wickelbanden zu weinen;
Denn, wo die Ufer zuerst
65An die Seit ihm schleichen, die krummen,
Und durstig umwindend ihn,
Den Unbedachten, zu ziehn
Und wol zu behüten begehren
Im eigenen Zahne, lachend
70Zerreisst er die Schlangen und stürzt
Mit der Beut’, und wenn in der Eil’
Ein Grösserer ihn nicht zähmt,
Ihn wachsen lässt, wie der Bliz, muss er
Die Erde spalten, und wie Bezauberte fliehn
75Die Wälder ihm nach, und zusammensinkend die Berge.
Ein Gott will aber sparen den Söhnen
Das eilende Leben und lächelt,
Wenn unenthaltsam, aber gehemmt
Von heiligen Alpen, ihm
80In der Tiefe, wie jener, zürnen die Ströme.
In solcher Esse wird dann
Auch alles Lautre geschmiedet,
Und schön ist’s, wie er drauf,
Nachdem er die Berge verlassen,
85Stillwandelnd sich im teutschen Lande
Begnüget, und das Sehnen stillt
Im guten Geschäffte, wenn er das Land baut –
Der Vater Rhein – und liebe Kinder nährt
In Städten, die er gründet.
Die fünfte Strophe lässt den Rhein noch einmal jeden Zwangs spotten. Wie Herakles die beiden von der eifersüchtigen Hera geschickten Schlangen zerriss, stürmt der Rhein an gegen die ihn schlangenartig umwindenden „krummen“ (Vers 65) Ufer und „stürzt / Mit der Beut“, mit Sand und Geröll davon. Die Gefahr besteht, dass er „wie der Bliz“ „Die Erde spalten“ will, sich anmaßt, was nur seinem Vater zusteht, der in Der Wanderer „das Gebirg hier / Spaltend mit Stralen <...> Höhen und Tiefen gebaut“.[28] Aber der Konditionalsatz „wenn <...> / Ein Größerer ihn nicht zähmt“ (Vers 71–72) zeigt die Geborgenheit im vorherbezeichneten Schicksal,[29] das Erbarmen (Vers 27) des Vaters.
Er, der „Gott“ (Vers 76) lenkt den ungebärdigen Sohn mit „heiligen Alpen“ – sie sind „die Noth / Und die Zucht“ von Vers 49 und 50 – in seine Bahn. Er „lächelt“ dabei (Vers 77) wie noch dreimal später im Gedicht, wenn von gelingendem Dasein die Rede ist (Vers 133, 172 und 215). Nach Norden fließend, „im teutschen Lande“ befruchtet der Rhein den Boden, nährt die Menschen und gründet Städte. Der „Quell“ von Vers 3 ist zum Strom, der „Jüngling“ (Vers 24) zum „Vater Rhein“ (Vers 88) geworden. Damit ist das Schicksal des Rheins in zwei Triaden beschrieben.
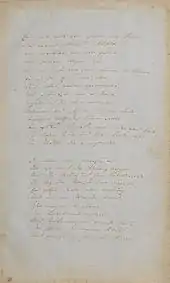
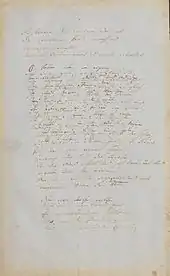
90Doch nimmer, nimmer vergisst ers.
Denn eher muss die Wohnung vergehn,
Und die Sazung und zum Unbild werden
Der Tag der Menschen, ehe vergessen
Ein solcher dürfte den Ursprung,
95Und die reine Stimme der Jugend.
Wer war es, der zuerst
Die Liebesbande verderbt
Und Strike von ihnen gemacht hat?
Dann haben des eigenen Rechts
100Und gewiss des himmlischen Feuers
Gespottet die Trozigen, dann erst
Die sterblichen Pfade verachtend
Verwegnes erwählt
Und den Göttern gleich zu werden getrachtet.
105Es haben aber an eigner
Unsterblichkeit die Götter genug, und bedürfen
Die Himmlischen eines Dings,
So sinds Heroën und Menschen
Und Sterbliche sonst. Denn weil
110Die Seeligsten nichts fühlen von selbst,
Muss wol, wenn solches zu sagen
Erlaubt ist, in der Götter Namen
Teilnehmend fühlen ein Andrer –
Den brauchen sie; jedoch ihr Gericht
115Ist, dass sein eignes Haus
Zerbreche der und das Liebste
Wie den Feind schelt’ und sich Vater und Kind
Begrabe unter den Trümmern,
Wenn einer, wie sie, sein will und nicht
120Ungleiches dulden, der Schwärmer.
Die dritte Triade sinnt ihm aber noch nach. Das Gleichgewicht zwischen dem heroischen Ursprung und der Annahme von Beschränkungen muss bewahrt werden. Bande müssen „Liebesbande“ (Vers 97) bleiben, dürfen nicht „Stricke“ werden. Sonst kann es zu Hybris der „Trozigen“ (Vers 101) kommen, wie beim Feuerraub des Prometheus, der „des himmlischen Feuers / Gespottet“ (Vers 100–101) hatte. Die Grammatik des Satzes „Dann haben des eigenen Rechts / Und gewiß des himmlischen Feuers / Gespottet die Trozigen“ erklärt Jochen Schmidt mit zwei kunstvoll verschachtelten Apokoinu-Konstruktionen. „Das ‚gewiß‘ steht apokoinu, d.h. in doppelseitigem Bezug zu dem voranstehenden Genitiv ‚des eigenen Rechts‘ wie zu dem nachstehenden Genitiv ‚des himmlischen Feuers‘; der Genitiv ‚des himmlischen Feuers‘ wiederum steht apokoinu zum vorausgehenden ‚gewiß‘ und zum nachfolgenden ‚gespottet‘.“ Diese syntaktische Verschränkung erst figuriere die Fülle und Dichte der logischen Verknüpfungen. Es ergebe sich als wesentliche Aussage, dass die Meinung, man sei des himmlischen Feuers „gewiß“, gleichbedeutend sei mit einem hybriden Sich-Hinwegsetzen („gespottet“) über dessen himmlisches („des himmlischen Feuers“), nicht verfügbares Wesen.[30] Wer sich aber gegen die Götter empört, der „Schwärmer“, der „nicht / Ungleiches dulden“ will (Vers 119–120), den stürzen sie in die Selbstvernichtung, bewirken, „dass sein eignes Haus / Zerbreche der und das Liebste / Wie den Feind schelt’ und sich Vater und Kind / Begrabe unter den Trümmern“ (Vers 115–118). So geschah es Herakles, den Hera in Wahnsinn stürzte, sodass er sein Haus zerstörte und Megara, seine Frau, und seine Kinder tötete.
Drum wol ihm, welcher fand
Ein wohlbeschiedenes Schicksal,
Wo noch der Wanderungen
Und süss der Leiden Erinnerung
125Aufrauscht am sichern Gestade,
Dass da und dorthin gern
Er sehn mag bis an die Grenzen
Die bei der Geburt ihm Gott
Zum Aufenthalte gezeichnet.
130Dann ruht er, selig bescheiden,
Denn alles, was er gewollt,
Das Himmlische, von selber umfängt
Es unbezwungen, lächelnd
Jezt, da er ruhet, den Kühnen.
Die neunte Strophe ist der Preis des Gelingens, der Bescheidung, der antihybriden Haltung. Mit dem „Gestade“ (Vers 125) wird noch einmal an den Rhein erinnert, jedoch so, daß er zugleich als Metapher für jeden dienen kann, der sich zu bescheiden gelernt hat.[31] Der Rhein bleibt seines Ursprungs eingedenk, „der Wanderungen“ und „der Leiden Erinnerung“. Aber die Erinnerung ist jetzt „süß“ (Vers 124); „lächelnd“ (Vers 133) – zweites Auftreten des Wortes – umfängt ihn „Das Himmlische“.
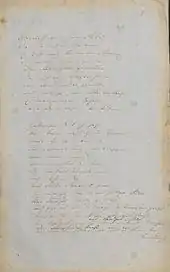

135Halbgötter denk’ ich jezt
Und kennen muss ich die Theuern,
Weil oft ihr Leben so
Die sehnende Brust mir beweget.
Wem aber, wie, Rousseau! dir,
140Unüberwindlich die Seele
Die starkausdauernde ward,
Und sicherer Sinn
Und süsse Gabe zu hören,
Zu reden so, dass er aus heiliger Fülle
145Wie der Weingott, thöricht göttlich
Und gesezlos sie, die Sprache der Reinesten, gibt
Verständlich den Guten, aber mit Recht
Die Achtungslosen mit Blindheit schlägt
Die entweichenden Knechte, wie nenn ich den Fremden?
150Die Söhne der Erde sind wie die Mutter
Allliebend, so empfangen sie auch
Mühlos, die Glücklichen, Alles.
Drum überraschet es auch
Und schreckt den sterblichen Mann,
155Wenn er den Himmel, den
Er mit den liebenden Armen
Sich auf die Schultern gehäuft,
Und die Last der Freude bedenket.
Dann scheint ihm oft das Beste,
160Fast ganz vergessen da,
Wo der Stral nicht brennt,
Im Schatten des Walds
Am Bielersee in frischer Grüne zu sein,
Und sorglos arm an Tönen,
165Anfängern gleich, bei Nachtigallen zu lernen.
Mit „Halbgötter denk’ ich jezt“ (Vers 135) setzt sich der Dichter zum ersten Mal nach der ersten Strophe wieder in ein ausdrückliches Verhältnis zum Gegenstand seines Gedichts. Das „jezt“ fasst eher das bisher Gesagte zusammen als dass es auf das Kommende vorausweist; denn der Rhein wurde schon in der zweiten Strophe ein Halbgott genannt (Vers 30), während Rousseau ein sterblicher Mann heißt (Vers 154). Er ist in Der Rhein mehr Dichter als Philosoph. „Verkörperte der Rhein den ‚kühnen‘ Helden und damit den Bereich des Aktiven und weltumgestaltender Tat, so steht nun Rousseau dagegen als Dichter“, der ‚die Sprache der Reinesten giebt‘ (Vers 146) und „mehr in den Bereich des Passiv-Empfangenden gehört.“[32] Hölderlin hat das Wort „Rousseau“ erst nachträglich in Vers 139 und die Wörter „am Bielersee“ erst nachträglich in Vers 163 der Handschrift H3 eingefügt (mit Bleistift). Rousseau hatte im September/Oktober 1765 Zuflucht auf der St. Petersinsel im Bielersee gefunden. Ursprünglich waren die Verse an den Adressaten des Gedichts, Heinse, gerichtet, auf den sie gut passen, weil Heinse in Hildegard von Hohenthal immer wieder den Gesang der Nachtigallen rühmt.[33] Hölderlin mochte sich wohl Heinse bei einem Rückzug in schattiges Grün „sorglos arm an Tönen, / Anfängern gleich, bei Nachtigallen“ lernend vorstellen. Jedenfalls lässt Hölderlin dem Bild des heroischen, stets dem tragischen Übermaß nahen Halbgotts Rhein das Bild des naturhaft schmiegsam reagierenden dichterischen Menschen Heinse/Rousseau folgen.[34]
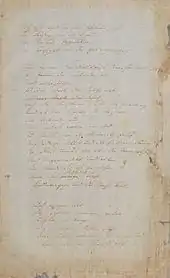
Und herrlich ists, aus heiligem Schlafe dann
Erstehen und aus Waldes Kühle
Erwachend, Abends nun,
Dem milderen Licht entgegenzugehn,
170Wenn, der die Berge gebaut
Und den Pfad der Ströme gezeichnet,
Nachdem er lächelnd auch
Der Menschen geschäftiges Leben
Das odemarme, wie Segel
175Mit seinen Lüften gelenkt hat,
Auch ruht und zu der Schülerin jezt,
Der Bildner, Gutes mehr
Denn Böses findend,
Zur heutigen Erde der Tag sich neiget. –
180Dann feiern das Brautfest Menschen und Götter,
Es feiern die Lebenden all,
Und ausgeglichen
Ist eine Weile das Schicksal.
Und die Flüchtlinge suchen die Herberg’,
185Und süssen Schlummer die Tapfern,
Die Liebenden aber
Sind, was sie waren, sie sind
Zu Hause, wo die Blume sich freuet
Unschädlicher Gluth und die finsteren Bäume
190Der Geist umsäuselt, aber die Unversöhnten
Sind umgewandelt und eilen,
Die Hände sich ehe zu reichen,
Bevor das freundliche Licht
Hinuntergeht und die Nacht kommt.
Der Preis des Gelingens dieses Lebensentwurfs wird mit dem Wort „herrlich“ eingeleitet; so mochte Hölderlin sein eigenes Leben ersehnen. Der Preis wird sogleich von Heinse/Rousseau auf den Vatergott übertragen, „der die Berge gebaut / Und den Pfad der Ströme gezeichnet“ – eine letzte Erinnerung an den Rhein. Der Vatergott lenkt auch, wieder „lächelnd“ (Vers 172) „Der Menschen geschäfftiges Leben“ (Vers 173). Ist die heutige Erde (Vers 179) in der zwölften Strophe die „Schülerin“ des Gottes, des Bildners (Vers 177), so wird sie in der dreizehnten Strophe seine Braut. „Ausgeglichen / Ist eine Weile das Schiksaal“ (Vers 182–183). Vier Beispiele erläutern den Ausgleich. Flüchtlinge suchen die Herberge, finden ein neues Daheim, Tapfere ruhen aus, Unversöhnte versöhnen sich. „Nur bei den Liebenden braucht sich nichts zu ändern. Sie ‚sind, was sie waren‘; denn die Liebe ist das Urbild der Versöhnung.“ Das „Brautfest“, die Erlösung dauern aber nur „eine Weile“. „Hölderlins gewöhnliche Vorstellung ist <...> die einer Welt, die in zyklischen Kreisen in den Sturm der Geschichte gerissen wird und dann wieder in die Erfüllung der Zeit zurückkehrt, aus der sie gekommen war.“[35]
195Doch einigen eilt
Dies schnell vorüber, andere
Behalten es länger.
Die ewigen Götter sind
Voll Lebens allzeit; bis in den Tod
200Kann aber ein Mensch auch
Im Gedächtnis doch das Beste behalten,
Und dann erlebt er das Höchste.
Nur hat ein jeder sein Maas.
Denn schwer ist zu tragen
205Das Unglück, aber schwerer das Glück.
Ein Weiser aber vermocht’ es
Vom Mittag bis in die Mitternacht,
Und bis der Morgen erglänzte,
Beim Gastmale helle zu bleiben.
Nach diesem Höhepunkt der Hymne[36] reflektiert die vierzehnte Strophe, was bleibt, wenn die „Weile“ (Vers 183) vorüber ist, „die Nacht kommt“ (Vers 194) wie im Johannesevangelium, wo die Nacht kommt, in der niemand mehr etwas tun kann (Joh 9,4 ). Der Mensch kann das Erfahrene „bis in den Tod <...> im Gedächtniß <...> behalten, / Und dann erlebt er das Höchste“. Dass dies Höchste, dies Glück schwerer zu tragen sei als Unglück, kehrt die gewohnten Maßstäbe um. Glück ist für Hölderlin Fülle des Seins und nur zu tragen, wenn „das eigene Innere dem Erinnerten adäquat ist, vom selben großen ‚Maß‘“.[37] Ähnlich preist Hölderlin im Januar 1801 in einem Brief an Anton von Gonzenbach „die schwerste und schönste aller Tugenden, die das Glük zu tragen“.[38] Der dies vermag, ist – dritter gelingender Lebensentwurf des Gedichts – „ein Weiser“ (Vers 206). Für ihn steht Sokrates, von dem Platon im Symposion berichtet, er sei beim abendlichen „Gastmahl“ (Vers 209) bis in den nächsten Morgen hinein als einziger wach, diskutierend, „helle“ geblieben. Er habe sich dann „zum Lykeion begeben, gebadet, und habe dort, wie sonst auch, den ganzen Tag zugebracht bis zum Abend und sei dann zu hause schlafen gegangen“.[39]
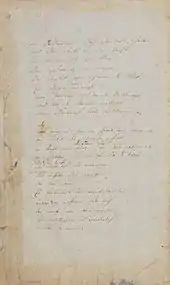
210Dir mag auf heissem Pfade unter Tannen oder
Im Dunkel des Eichwalds gehüllt
In Stahl, mein Sinclair! Gott erscheinen oder
In Wolken, du kennst ihn, da du kennest, jugendlich,
Des Guten Kraft, und nimmer ist dir
215Verborgen das Lächeln des Herrschers
Bei Tage, wenn
Es fieberhaft und angekettet das
Lebendige scheinet oder auch
Bei Nacht, wenn alles gemischt
220Ist ordnungslos und wiederkehrt
Uralte Verwirrung.
Die Strophe enthält noch einmal die Umwidmung: In Vers 212 steht in „H3“ „Sinklair!“ über gestrichenem „Heinze!“ Jedoch passen die ursprünglich Heinse geltenden Wendungen gut zu Sinclair, seiner Landschaft und der Zeit: „auf heißem Pfade“ zu Sinclairs angespannter politischer Tätigkeit; „unter Tannen oder / Im Dunkel des Eichwalds“ zu seinen philosophisch-dichterischen Bemühungen sowie zum Homburg nahen Taunus, über den Hölderlin in Der Wanderer gedichtet hatte „Aber lächelnd und ernst ruht droben der Alte, der Taunus, / Und mit Eichen bekränzt neiget der Freie das Haupt“;[40] Gott „gehüllt / In Stahl“ zu den Koalitionskriegen.
Die letzten Verse greifen noch einmal zentrale Motive auf. „Das / Lebendige“ (Vers 218–219) steht im Dilemma von Bindung und Ungebundenheit, Heteronomie und Autonomie, Passivität und Aktivität, Chaos, uralter Verwirrung (Vers 221) und Ordnung.[41] Im „Lächeln des Herrschers“ (Vers 215) „gipfelt die Motivreihe, die vom Lächeln des Gottes spricht. Das Lächeln der Gottheit deutet auf die Harmonie von Idealität und Realität, von ‚Himmel‘ und ‚Erde‘“.[42] „Der Abgrund ist immer da, aber die Himmlischen sind auch da und sind die stärkeren, selbst wenn sie einmal für eine Weile die Mächte des Abgrunds gewähren lassen.“[43]
Literatur
- Johanne Autenrieth und Alfred Kelletat: Katalog der Hölderlin-Handschriften. Veröffentlichungen des Hölderlin-Archivs 3. Kohlhammer Verlag, Stuttgart 1961.
- Adolf Beck und Paul Raabe: Hölderlin. Eine Chronik in Text und Bild. Insel-Verlag, Frankfurt am Main 1970.
- Wolfgang Binder: Hölderlins Rhein-Hymne. In: Bernhard Böschenstein (Hrsg.): Hölderlin-Jahrbuch 29/30, 1975–1977, ISBN 3-16-939401-0, S. 131–155.
- Bernhard Böschenstein: Hölderlins Rheinhymne. 2. Auflage. Atlantis Verlag, Zürich 1968.
- Ulrich Gaier: Hölderlin. Eine Einführung. Francke Verlag, Tübingen und Basel 1993. ISBN 3-7720-2222-7.
- Ulrich Gaier: Rousseau, Schiller, Herder, Heinse. In: Johann Kreuzer (Hrsg.): Hölderlin-Handbuch, Leben – Werk – Wirkung. J. B. Metzler’sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart 2002, ISBN 3-476-01704-4, S. 72–89.
- Ulrich Gaier: Aufmerksamkeits-Ebenen. Ein Hölderlin-Lehrgang. Internetseite der Hölderlin-Gesellschaft ohne Jahr. Abgerufen am 2. Juni 2014.
- Martin Heidegger: Hölderlins Hymnen „Germanien“ und „Der Rhein“. Vittorio Klostermann Verlag, Frankfurt am Main 1980.
- Friedrich Hölderlin: Der Rhein in: Digitalisate der Württembergischen Landesbibliothek, Stuttgart. Abgerufen am 2. Juni 2014.
- Friedrich Hölderlin: Sämtliche Werke. Große Stuttgarter Ausgabe. Herausgegeben von Friedrich Beissner, Adolf Beck und Ute Oelmann. Stuttgarter Ausgabe. Kohlhammer Verlag, Stuttgart 1943 bis 1985.
- Friedrich Hölderlin: Sämtliche Werke. Historisch-kritische Ausgabe in 20 Bänden und 3 Supplementen. Herausgegeben von Dietrich Sattler. Frankfurter Ausgabe. Verlag Stroemfeld/Roter Stern, Frankfurt am Main und Basel 1975–2008.
- Friedrich Hölderlin: Sämtliche Werke und Briefe. Herausgegeben von Michael Knaupp. Carl Hanser Verlag, München 1992 bis 1993.
- Friedrich Hölderlin: Gedichte. Herausgegeben von Jochen Schmidt. Deutscher Klassiker Verlag, Frankfurt am Main 1992, ISBN 3-618-60810-1.
- Walter Hof: Hölderlins Stil als Ausdruck seiner geistigen Welt. Westkulturverlag Anton Hain, Meisenheim am Glan 1954.
- Walter Hof: Die Schwierigkeit, sich über Hölderlin zu verständigen. Verlag Lothar Rotsch, Tübingen 1977, ISBN 3-87674-022-3.
- Bart Philipsen: Gesänge (Stuttgart, Homburg). In: In: Johann Kreuzer (Hrsg.): Hölderlin-Handbuch, Leben – Werk – Wirkung. J. B. Metzler’sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart 2002, ISBN 3-476-01704-4, S. 347–378.
Einzelnachweise
- Philipsen 2002, S. 352.
- Stuttgarter Ausgabe Band 6, 1, S. 436.
- Stuttgarter Ausgabe Band 6, 1, S. 435.
- siehe Literatur.
- siehe Literatur.
- Schmidt 1992, S. 855.
- Stuttgarter Ausgabe Band 1, 1, S. 130.
- Brod und Wein Vers 65, Stuttgarter Ausgabe Band 2, 1, S. 92.
- Stuttgarter Ausgabe Band 2, 1, S. 90.
- Stuttgarter Ausgabe Band 2, 1, S. 252 und Band 2, 2, S. 890.
- Gaier 2002, S. 89.
- Stuttgarter Ausgabe Band 6, 1, S. 238–239.
- Beck und Raabe 1970, S. 381.
- Stuttgarter Ausgabe Band 2, 1, S. 165.
- Stuttgarter Ausgabe Band 2, 2, S. 462.
- Schmidt 1992, S. 856.
- Das Wort leitet sich von den Hesperiden ab, die in ihrem Garten im fernsten Westen einen Baum mit goldenen Äpfeln bewachten. Hölderlin meinte damit etwa in Brod und Wein Vers 150 – „Siehe! wir sind es, wir, Frucht von Hesperien ists!“ – das außergriechische Abendland, besonders Deutschland. Griechenland bezeichnete für ihn den vergangenen, Hesperien den künftigen Göttertag des Abendlandes. Stuttgarter Ausgabe Band 2, 2, S. 619–620.
- Stuttgarter Ausgabe Band 2, 1, S. 166.
- Schmidt 1992, S. 859.
- Stuttgarter Ausgabe Band 6, 1, S. 414.
- Böschenstein 1968, S. 36.
- Stuttgarter Ausgabe Band 2, 1, S. 81.
- Böschenstein 1968, S. 44.
- Schmidt 1992, s. 860.
- Böschenstein 1968, S. 51; Binder 1975–1977, S. 140.
- Böschenstein 1968, S. 56.
- „Eine Dichtung, die so inflationär mit dem Wort ‚heilig‘ umspringt, sollte man nicht ohne Widerspruch hinnehmen,“ schrieb Marcel Reich-Ranicki 1987, als er begründete, warum er Hölderlin nicht liebe. Marcel Reich-Ranicki: Hölderlin und eine Annäherung. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 27. Juni 1987. Dreizehn Jahre später differenzierte er aber sein Urteil. „So verneige ich mich vor Friedrich Hölderlin in Bewunderung und in Dankbarkeit. Und immer noch ganz ohne Liebe? <...> Ich weiß schon, ich weiß es heute besser als damals: Wo ich mich vor der deutschen Dichtung in Dankbarkeit und in Bewunderung verneige, da ist stets auch sie im Spiel, die Liebe.“ Marcel Reich-Ranicki: Kein Rabatt für Märtyrer. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 24. Juni 2000.
- Stuttgarter Ausgabe Band 2, 1, S. 80.
- Böschenstein 1968, S. 61.
- Schmidt 1992, S. 865.
- Binder 1975–1977, S. 145.
- Schmidt 1992, S. 866–867.
- Hildegard von Hohenthal Erster Theil: „Unter allen Thieren hat der Mensch das vollkommenste Stimmorgan; die Nachtigall unter den Vögeln das einfachste.“ Es folgt ein Passus über das Lernen des Gesangsschülers.
- Hof 1977, S. 101–103.
- Binder 1975–1977, S. 149–150.
- Binder 1975–1977, S. 150.
- Schmidt 1992, S. 871.
- Stuttgarter Ausgabe Band 6, 1, S. 409.
- Stuttgarter Ausgabe Band 2, 2, S. 738.
- Stuttgarter Ausgabe Band 2, 1, S. 81.
- Philipsen 2002, S. 362.
- Schmidt 1992, S. 873.
- Binder 1975–1977, S. 152.