Marthozit
Marthozit ist ein sehr selten vorkommendes Uran-Mineral aus der Mineralklasse der „Oxide und Hydroxide“ (einschließlich V[5,6]-Vanadate, Arsenite, Antimonite, Bismutite, Sulfite, Selenite, Tellurite und Iodate). Es kristallisiert im orthorhombischen Kristallsystem mit der chemischen Zusammensetzung Cu(UO2)3(SeO3)2O2·8H2O[1], ist also ein wasserhaltiges Kupfer-Uranyl-Selenit.
| Marthozit | |
|---|---|
 | |
| Allgemeines und Klassifikation | |
| Chemische Formel | Cu(UO2)3(SeO3)2O2·8H2O[1] |
| Mineralklasse (und ggf. Abteilung) |
Oxide und Hydroxide |
| System-Nr. nach Strunz und nach Dana |
4.JJ.05 (8. Auflage: IV/K.11) 34.07.04.01 |
| Kristallographische Daten | |
| Kristallsystem | orthorhombisch |
| Kristallklasse; Symbol | orthorhombisch-pyramidal mm2[2] |
| Raumgruppe (Nr.) | Pbn21 (Nr. 33) |
| Gitterparameter | a = 16,4537 Å; b = 17,2229 Å; c = 6,9879 Å[3] |
| Formeleinheiten | Z = 4[3] |
| Physikalische Eigenschaften | |
| Mohshärte | 6[2] |
| Dichte (g/cm3) | 4,44[2] |
| Spaltbarkeit | vollkommen nach {100}, undeutlich nach {010}[2] |
| Farbe | gelblichgrün bis grünlichbraun |
| Strichfarbe | gelb |
| Transparenz | durchscheinend bis undurchsichtig |
| Glanz | Bitte ergänzen |
| Radioaktivität | sehr stark |
| Kristalloptik | |
| Optischer Charakter | zweiachsig negativ |
| Achsenwinkel | 2V = gemessen: 39°[3] |
| Pleochroismus | X = gelblich braun; Y = Z = grünlich gelb |
Marthozit entwickelt häufig gelbgrüne, pyramidale Kristalle sowie gelbe Aggregate.
Etymologie und Geschichte
Marthozit wurde erstmals an einer Mineralprobe aus der Musonoi Mine in Katanga (heute: Demokratische Republik Kongo) entdeckt und 1969 durch Fabien Cesbron, Robert Oosterbosch und Roland Pierrot beschrieben, die das Mineral nach dem französischen Mineralogen Aime Marthoz (1864–1962) benannten.[4]
Die von den Erstbeschreibern zunächst angegebene Summenformel Cu(UO2)3(SeO3)3(OH)2·7H2O konnte im Jahre 2001 durch Einkristallstrukturanalyse zu Cu(UO2)3(SeO3)2O2·8H2O korrigiert werden.[1]
Das Typmineral wird unter der Katalognummer 12.252 im Naturhistorischen Museum in Paris aufbewahrt.[3]
Klassifikation
Die veraltete 8. Auflage des Strunz listet den Marthozit unter „Uranylselenite mit Baugruppen [UO2]2+ bis [SeO3]2−“ mit der System-Nr. IV/K.11 zusammen mit Demesmaekerit, Derriksit, Guilleminit, Haynesit, Larisait und Piretit.
Die 9., vollständig überarbeitete Auflage des Strunz listet den Marthozit in der Abteilung J „Selenite mit zusätzlichen Anionen; mit H2O“ als einzigen Vertreter der Gruppe 4.JJ.05.
Die im englischen Sprachraum gebräuchliche Systematik der Minerale nach Dana ordnet den Marthozit unter die Selenite - Tellurite - Sulfite innerhalb der Sulfate, Chromate und Molybdate mit der System-Nr. 34.07.04.01 ein.
Kristallstruktur
Marthozit kristallisiert im orthorhombischen Kristallsystem in der Raumgruppe Pbn21 (Raumgruppen-Nr. 33, Stellung 2) mit den Gitterparametern a = 16,4537 Å; b = 17,2229 Å; c = 6,9879 Å und 4 Formeleinheiten pro Elementarzelle.[5]
Die Kristallstruktur von Marthozit weist drei unterschiedliche Uranyl-Einheiten auf, wovon eine hexagonal-bipyramidal, die anderen beiden pentagonal-bipyramidal von Sauerstoffatomen umgeben sind. Die Selenit-Einheiten bilden trigonale Pyramiden mit dem Selenatom als Spitze. So entstehen Schichten aus Uranyl-Kationen und Selenit-Anionen, die untereinander durch die Cu2+-Ionen verbrückt werden. Die Kupfer-Ionen koordinieren jedoch ausschließlich die pentagonal-bipyramidalen Uranyleinheiten. Das Kupfer selbst ist dabei von vier Einheiten Kristallwasser umgeben, so dass es oktaedrisch von sechs Sauerstoffatomen umgeben ist.
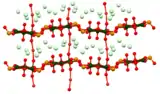 Schichtstruktur von Marthozit in Richtung der kristallographischen a-Achse (__ U __ O __ Se __ Cu __ Wassermoleküle)
Schichtstruktur von Marthozit in Richtung der kristallographischen a-Achse (__ U __ O __ Se __ Cu __ Wassermoleküle)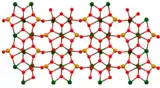
Eigenschaften
Das Mineral ist durch seinen Urangehalt von bis zu 54,78 % radioaktiv. Unter Berücksichtigung der Mengenanteile der radioaktiven Elemente in der idealisierten Summenformel sowie der Folgezerfälle der natürlichen Zerfallsreihen wird für das Mineral eine spezifische Aktivität von etwa 98 kBq/g[2] angegeben (zum Vergleich: natürliches Kalium 0,0312 kBq/g). Der zitierte Wert kann je nach Mineralgehalt und Zusammensetzung der Stufen deutlich abweichen, auch sind selektive An- oder Abreicherungen der radioaktiven Zerfallsprodukte möglich und ändern die Aktivität.
Modifikationen und Varietäten
Sowohl Cesbron, Oosterbosch und Pierrot als auch Cooper und Hawthorn berichten von einer Meta-Form des Marthozit. Die Arbeit der letztgenannten Autoren gibt für Metamarthozit eine Summenformel von Cu(UO2)3(SeO3)2O2·6H2O an. Er kristallisiert ebenfalls orthorhombisch mit ähnlichen Zelldimensionen, wobei lediglich die b-Achse auf 15,8 Å verkürzt ist.[1]
Bildung und Fundorte
Marthozit bildet sich als sekundäres Uranmineral in der Oxidationszone selenreicher hydrothermaler Uranerze. Es findet sich vergesellschaftet mit Digenit, Demesmaekerit, Denningit, Guilleminit. Neben der Typlokalität in der Kasolo Mine bei Kolwezi findet sich Marthozit weltweit nur noch im „La Creusaz U prospect“ in Les Marécottes im Kanton Wallis in der Schweiz sowie möglicherweise in Moldava bei Dubí in der Tschechischen Republik.[5]
Vorsichtsmaßnahmen
Auf Grund der starken Radioaktivität des Minerals sollten Mineralproben vom Marthozit nur in staub- und strahlungsdichten Behältern, vor allem aber niemals in Wohn-, Schlaf- und Arbeitsräumen aufbewahrt werden. Ebenso sollte wegen der hohen Toxizität und Radioaktivität von Uranylverbindungen eine Aufnahme in den Körper (Inkorporation, Ingestion) auf jeden Fall verhindert und zur Sicherheit direkter Körperkontakt vermieden sowie beim Umgang mit dem Mineral Mundschutz und Handschuhe getragen werden.
Siehe auch
Literatur
- Marthozite, In: John W. Anthony, Richard A. Bideaux, Kenneth W. Bladh, Monte C. Nichols (Hrsg.): Handbook of Mineralogy, Mineralogical Society of America, 2001 (PDF 71,4 kB)
Weblinks
Einzelnachweise
- Mark A. Cooper, Frank C. Hawthorne: Structure topology and hydrogen bonding in marthozite, Cu2+[(UO2)3(SeO3)2O2](H2O)8, a comparison with guilleminite, Ba[(UO2)3(SeO3)2O2](H2O)3. In: The Canadian Mineralogist. 2001, Band 39, S. 797–807. (PDF, 522 kB (englisch)).
- Marthozite bei Webmineral.com.
- Marthozite, In: John W. Anthony, Richard A. Bideaux, Kenneth W. Bladh, Monte C. Nichols (Hrsg.): Handbook of Mineralogy, Mineralogical Society of America, 2001 (PDF 71,4 kB).
- Fabien Cesbron, R. Oosterbosch, Roland Pierrot: Une nouvelle espèce minérale: la marthozite. Uranyl-sélénite de cuivre hydraté. In: Bulletin de la Société Française de Minéralogie et de Cristallographie. 1969, Band 92, S. 278–283 (PDF, 294 kB (französisch)).
- Mindat - Marthozite.