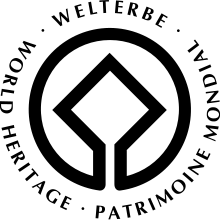Ajanta-Höhlen
Die seit dem Jahr 1983 zum UNESCO-Weltkulturerbe zählenden Ajanta-Höhlen im Bundesstaat Maharashtra gehören – neben denen von Ellora – zu den meistbesuchten Kulturstätten Indiens.
| Ajanta-Höhlen अजंता गुफाएँ | |
|---|---|
| UNESCO-Welterbe | |
 | |
| Talkessel mit den Ajanta-Höhlen | |
| Vertragsstaat(en): | |
| Typ: | Kultur |
| Kriterien: | (i)(ii)(iii)(vi) |
| Fläche: | 8,242 ha |
| Referenz-Nr.: | 242 |
| UNESCO-Region: | Asien und Pazifik |
| Geschichte der Einschreibung | |
| Einschreibung: | 1983 (Sitzung 7) |

Lage
Die Höhlen liegen in einem Talkessel etwa 4 km (Luftlinie) westlich der Kleinstadt Ajanta (Marathi अजिंठा, Ajiṇṭhā) im Norden des indischen Bundesstaates Maharashtra. Die nächste Stadt mit einer Bahnstation, Jalgaon, ist rund 77 km entfernt, doch meist werden die Höhlen im Rahmen einer Tagestour zusammen mit denen von Ellora von der knapp 100 km südlich gelegenen Stadt Aurangabad angefahren. Von dort verkehren auch öffentliche Busse und Taxis.
In einem steil durch den – nur in und nach der Monsunzeit wasserführenden – Fluss Waghora in den Fels eingeschnittenen, U-förmigen Tal findet man zahlreiche in den Fels getriebene, große Höhlentempel.
Geschichte
Vom 2. Jahrhundert vor bis zum Ende des 7. Jahrhunderts nach der Zeitenwende war das Tal von buddhistischen Mönchen bewohnt. Während der Vakataka-Dynastie im 5. Jahrhundert wurden die meisten Höhlen gebaut, wenngleich die Vertreter des Vakataka als Anhänger des Brahmanismus selbst nicht Hand anlegten. Die Baumeister waren anfänglich die Mönche selbst; später wurden die einfachen, vielleicht aber auch Teile der komplizierteren Arbeiten von geschulten und bezahlten Steinmetzen erledigt. Nach offizieller Zählung des Archaeological Survey of India wurden 29 große Höhlen in den Fels getrieben; diese waren bis zu 30 m breit und tief (Höhle 4) und ca. 4 bis 8 m hoch. Aus verschiedenen Gründen (schmucklose Stützen und Architrav, anikonischer Stupa) kann man davon ausgehen, dass die Höhle 10 die älteste aller Höhlen von Ajanta ist und im 2. Jahrhundert v. Chr. geschaffen wurde. Die Bauphasen und Meißelzeiten schwanken je nach Größe und Dekor pro Höhle zwischen 1 und 5 Jahren. Im 7./8. Jahrhundert erreichte eine Welle der Feindlichkeiten gegen Buddhisten in ganz Indien auch dieses abgeschiedene Tal. Die Mönche wurden vertrieben; die Höhlen gerieten in Vergessenheit und wurden im Laufe der Zeit vom Verwitterungsschutt der darüberliegenden Felswände verdeckt.
Im April 1819 passierte eine Truppeneinheit der britischen Madras-Armee das Ajanta-Ghat. Während einer Tigerjagd ergründete der britische Kavallerieoffizier John Smith die kaum zugängliche Schlucht und entdeckte die seit Jahrhunderten verwaisten Höhlentempel (in Höhle 10 hinterließ er eine kurze Inschrift). Weitere Höhlen wurden nach und nach freigelegt.[1]
Architektur
Von den insgesamt 29 Höhlen sind nur vier (Nrn. 9, 10, 19 und 26) als längserstreckte Hallenräume reine Kulthöhlen (chaityas). Die meisten anderen Höhlen sind Wohnhöhlen (viharas) mit einem Kultbildraum für eine Buddhafigur oder sogar reine Wohnhöhlen. Die gemischten Wohnhöhlen mit Kultbildraum bestehen oft aus einer quergelagerten Vorhalle mit Stützenstellung und einer anschließenden Stützenhalle mit Umgang, von dem die Zellen abgehen. Die Eingangsseite hat meist einige Fenster. In der Achse des Eingang befindet sich ein mit Stützenstellung abgetrennter Raum für eine raumhohe Buddhafigur, in einigen Höhlen zusätzlich mit einem Vorraum. Die quadratischen aber auch rechteckigen Wohnhöhlen sind oft breiter als tief, wohingegen die dreischiffigen, im hinteren Bereich abgerundeten reinen Kulthöhlenhallen insgesamt eher schmal, aber sowohl tiefer als auch höher als die Wohnhöhlen sind – bei ihnen werden Anlehnungen an die ältere, aber nicht erhaltene Holzbauweise deutlich (z. B. in den Dachsparren). Beim Betreten der gemischten vihara-Höhlen wird der Blick meist auf eine gegenüberliegende Nische mit einer aus dem Fels gehauenen sitzenden Buddha-Statue gelenkt; der Blickfang in den chaitiya-Höhlen ist dagegen ein Stupa mit einer manchmal davor befindlichen Buddha-Statue.
Malereien

Die bedeutendsten Höhlen wurden mit Wandputz versehen, auf dem mit Mineralfarben Szenen aus dem Leben Buddhas dargestellt sind, die sich sehr wahrscheinlich am höfischen Leben der Zeit ihrer Entstehung orientieren – interessant sind hier vor allem die Frisuren, die Kleidung und der Schmuck der Frauen. In einer Höhle huldigen zwei Krieger dem Buddha, der eine in chinesischer und der andere in römischer Soldatenkleidung – es muss also bereits damals ein kultureller Austausch zwischen Indien und dem Mittelmeerraum stattgefunden haben. Da das römische Reich zur Zeit seiner maximalen Ausdehnung auch das Gebiet Mesopotamiens umfasste, reichte möglicherweise eine Verbindung dorthin für die Kenntnis römischer Uniformen.
Die Maler beherrschten die Trompe-l’œil-Malerei so gut, dass dem Betrachter in einer anderen Szene ein gemalter Balkon entgegen zu ragen scheint.
Die einzelnen Höhlen
Höhle 1
Höhle Nr. 1 ist ein Vihara mit einem Vorhof, einer vorgelagerten Veranda, einem rechteckigen Hauptraum von 35,7 × 27,6 m mit einem Säulenumgang von 20 skulptierten Stützen, einem Kultbildraum mit vorgelagertem kleinen Vorraum in der Mittelachse. An den Seitenwänden gehen die 12 Zellenräume ab. Die Decke und die Seitenwände sind reich bemalt, an den Seitenwänden mit Szenen aus dem Leben des Buddha.
- Höhle 1
 Vorhof mit Blick auf Seitengalerie und Veranda
Vorhof mit Blick auf Seitengalerie und Veranda Säule mit gedrehten Kanneluren, skulptiertem Kapitel und Architrav. Rechts befindet sich der Eingang zur Höhle
Säule mit gedrehten Kanneluren, skulptiertem Kapitel und Architrav. Rechts befindet sich der Eingang zur Höhle bemalte Seitenwand mit zwei Zelleneingängen
bemalte Seitenwand mit zwei Zelleneingängen Stirnseite mit Kultbildraum hinter Vorraum und bemalten Wänden
Stirnseite mit Kultbildraum hinter Vorraum und bemalten Wänden Blick vom Vorraum in Kultbildraum, Buddha mit seitlichem Bodhisattva
Blick vom Vorraum in Kultbildraum, Buddha mit seitlichem Bodhisattva
Höhle 2
Höhle Nr. 2 ist ein Vihara mit vorgelagerter Veranda, rechteckigem Hauptraum von 35,7 × 21,6 m mit einem Säulenumgang von 12 Säulen, von dem 10 Mönchszellen abgehen, einem Kultbildraum mit vorgelagertem, kleinen Vorraum in der Mitte der Stirnseite. Der Kultbildraum für den Buddha wird flankiert von zwei ebenfalls mit Doppelstützen abgetrennten Kapellen. Die eine ist Shankhanidhiti-Padmanidhi gewidmet, einer Gottheit die Wohlstand spendet, die andere Hariti-Panchika, die Mutterschaft personifiziert. Die Höhle ist bereits in der Veranda reich ausgemalt.
- Höhle 2
 Eingang von der Veranda in den Höhlenraum
Eingang von der Veranda in den Höhlenraum Stirnseite mit Blick auf den Kultbildraum und die seitlichen Kapellenräume
Stirnseite mit Blick auf den Kultbildraum und die seitlichen Kapellenräume Blick durch den Vorraum auf den Kultbildraum mit Buddhafigur
Blick durch den Vorraum auf den Kultbildraum mit Buddhafigur bemalter Vorraum zum Kultbildraum
bemalter Vorraum zum Kultbildraum bemalte Seitenwand mit Zelleneingang
bemalte Seitenwand mit Zelleneingang
Höhle 4
Höhle 4 ist ein Vihara, mit vorgelagerter Veranda, reich skulptiertem Eingang, Säulenumgangshalle mit 28 achteckigen Stützen, 15 Zellen, links roh angefangener Kapelle und roh gearbeiteter Decke mit hängendem Felsgestein. Der Vorraum zum Kultbildraum mit Buddhafigur und seitlichen Bodhisattvas ist mit großen Bodhisattvafiguren in Halbrelief ausgestattet. Die Höhle 4 weist keine Malereien auf.
- Höhle 4
 Veranda
Veranda Eingangstor
Eingangstor Relieffeld neben dem Eingang
Relieffeld neben dem Eingang Bild durch den Vorraum zum Kultbildraum mit Buddhafigur
Bild durch den Vorraum zum Kultbildraum mit Buddhafigur Figuren im Vorraum zum Kultbildraum, der durch Säule in Bildmitte verdeckt ist
Figuren im Vorraum zum Kultbildraum, der durch Säule in Bildmitte verdeckt ist Zelle mit Nische
Zelle mit Nische
Höhle 5
Höhle 5 ist unvollendet und sollte wohl ein Vihara werden. Hinter der niedrigen Veranda führt ein skulptiertes Eingangstor zu einem roh ausgehauenen Raum, in dem man den Anfang einer Säulenumgangshalle erkennen kann. Die Höhle ist auch deshalb interessant, weil sich hier Erkenntnisse zur Technik der Baumeister gewinnen lassen.
- Höhle 5
 Eingangstor
Eingangstor Blick durch den Eingang
Blick durch den Eingang Inneres
Inneres
Höhle 6
Höhle 6 ist ein doppelstöckiges Vihara. Das Erdgeschoss direkt hinter einer relativ schmucklosen Felsfassade bildet eine Pfleilerhalle mit 16 Stützen auf T-fömigem Grundriss, 17 Mönchszellen, Vorraum zum Kultbildraum mit Buddhafigur. Eine Treppe führt rechts vom Eingang ins Obergeschoss.
Das Obergeschoss verfügt im Unterschied zum Erdgeschoss über eine sich zum Tal hin öffnende Veranda mit Seitenräumen. Dahinter befindet sich ein Säulenumgangsraum mit 12 Pfeilern, stirnseitigem Kultbildraum mit Vorraum und seitenseitigen Kapellen, die von jeweils einer Doppelsäulenstellung markiert werden.
- Höhle 6
 Eingang Erdgeschoss
Eingang Erdgeschoss Erdgeschoss Durchblick
Erdgeschoss Durchblick Erdgeschoss, Treppe zum Obergeschoss
Erdgeschoss, Treppe zum Obergeschoss Erd- und Obergeschoss
Erd- und Obergeschoss Obergeschoss Durchblick
Obergeschoss Durchblick Obergeschoss, Blick vom Vorraum zum Kultbildraum
Obergeschoss, Blick vom Vorraum zum Kultbildraum Obergeschoss, Pfeiler mit Buddhakapitell
Obergeschoss, Pfeiler mit Buddhakapitell Blick auf eine der beiden Seitenkapellen
Blick auf eine der beiden Seitenkapellen
Höhle 7
Höhle Nr. 7 ist ein Vihara, besitzt statt der galeriartigen Veranda zwei risalitartige Vorsprünge auf Säulen, eine quergelagerte Vorhalle mit erhöhten Seitenräumen. Von dieser Querhalle geht mittig direkt der Vorraum und der Kultbildraum mit zentraler Buddhafigur, seitlichen Bodhisattvas und Apsaras ab. Der Vihara bietet acht Mönchszellen.
- Höhle 7
 risalitartiger Vorbau
risalitartiger Vorbau quergelagerte Vorhalle mit erhöhten Seitenräumen
quergelagerte Vorhalle mit erhöhten Seitenräumen Blick durch den Vorraum auf den Kultbildraum
Blick durch den Vorraum auf den Kultbildraum seitlicher Blick in den Kultbildraum
seitlicher Blick in den Kultbildraum
Höhle 9
Höhle Nr. 9 ist eine Chaitya-Halle, also ein Kult- und Verehrungsbau ohne Wohnfunktionen. Sie bildet eine längserstreckte Halle mit halbrundem Abschluss und tonnenförmiger Decke aus. Ein Umgang mit flacher Decke ist mit 22 achteckigen Stützen von der Mittelhalle abgesetzt. Das Zentrum und Ziel der Halle bildet ein Stupa in der hinteren Abschlusszone.
- Höhle 9
 Fassade
Fassade Halle mit Stupa
Halle mit Stupa Umgang mit Stützen
Umgang mit Stützen Fassade von innen
Fassade von innen
Höhle 10
Höhle Nr. 10 ist eine Chaitya-Halle mit oktogonalen Pfeilern zum halbtonnengewölbeartig nach oben abgeschlossenen Seitenumgang. Sie ist höher und tiefer als die benachbarte Chaitya-Höhle 9.
- Höhle 10
 Blick zum Stupa
Blick zum Stupa Blick in Umgang mit zwei Stützen
Blick in Umgang mit zwei Stützen Fassade von innen
Fassade von innen
Höhle 11
Höhle Nr. 11 ist ein Vihara, der höher gelegen, über eine Treppe erreichbar ist. Hinter der Veranda mit 4 Stützen ist der Säulenumgangsraum mit vier, elegant konkav gekurvten, achteckigen Stützen und Kissenkapitellen ausgebildet. Von ihm gehen sechs Zellen aus. Die Buddhafigur ist in ihrem Kultbildraum umschreitbar.
- Höhle 11
 Veranda
Veranda Blick zum Kultbildraum
Blick zum Kultbildraum
Höhle 12
Höhle Nr. 12 ist eine reine Wohnhöhle mit einem stützenlosen, niedrigen Zentralraum, von dem 12 Zellen abgehen. Die Zellen und Zellenzwischenräume sind mit Kudus geschmückt.
- Höhle 12
 Inneres
Inneres Zelleneingang mit Kudus
Zelleneingang mit Kudus
Höhle 14
Höhle Nr. 14 bildet einen Doppelraum, der durch zwei Stützen in einen Vorder- und Hinterraum gegliedert ist. Im Hinterraum befindet sich ein Brunnen.
 Ajanta, Höhle 14
Ajanta, Höhle 14
Höhle 15
Höhle Nr. 15 ist ein Vihara mit stützenlosem Raum mit Kultbildraum und neun Zellen. Es wird auch als Besucherinformationsbüro genutzt.
- Höhle 15
 Eingang
Eingang Blick zum Kultbildraum, rechts Besucherinformation
Blick zum Kultbildraum, rechts Besucherinformation zentrale Buddhafigur mit beleuchtung von unten und "strengem" Gesichtsausdruck
zentrale Buddhafigur mit beleuchtung von unten und "strengem" Gesichtsausdruck „lächelnde“ Buddhafigur mit Beleuchtung von links
„lächelnde“ Buddhafigur mit Beleuchtung von links Relieffelder mit thronendem Buddha und Buddha im Lotussitz
Relieffelder mit thronendem Buddha und Buddha im Lotussitz
Höhle 16
Höhle Nr. 16 ist ein Vihara erreichbar über einen von zwei Elefantenreliefs flankierten Treppenaufgang. Das Kloster ist das größte der Höhlenklöster von Ajanta und misst 19,5 × 22,25 × 4,6 m. Es verfügt über eine Veranda, eine quergelagerte Vorhalle und einen Säulenumgangsraum mit 20 Stützen, einen Kultbildraum ohne Vorraum, weitere Kapellen zu beiden Seiten und 14 Zellen.
- Höhle 16
 Aufgang mit Elefant links und darüber liegender Veranda
Aufgang mit Elefant links und darüber liegender Veranda Eingang
Eingang Durchblick zum Kultbildraum
Durchblick zum Kultbildraum Kultbildraum
Kultbildraum Seitenwand mit zwei Zelleneingängen und Malereien
Seitenwand mit zwei Zelleneingängen und Malereien Gebälkimmitationen in der Vorhalle
Gebälkimmitationen in der Vorhalle
Höhle 17
Höhle Nr. 17 ist ein Vihara mit Veranda, Säulenumgangsraum mit 20 oktogonalen Stützen und reichem Skulpturenschmuck, Kultbildraum mit Vorraum. In Höhle Nr. 17 haben sich besonders reiche Malereien erhalten.
- Höhle 17
 Durchblick zum Kultbildraum
Durchblick zum Kultbildraum Blick zum Kultbildraum mit Deckenmalerei
Blick zum Kultbildraum mit Deckenmalerei Blick schräg zum Kultbildraum mit Bodhisattva-Figur und Malerei auf Stirnwand
Blick schräg zum Kultbildraum mit Bodhisattva-Figur und Malerei auf Stirnwand Malerei auf Seitenwand mit Zelleneingang
Malerei auf Seitenwand mit Zelleneingang Malerei auf Eingangswand
Malerei auf Eingangswand
Höhle 19
Höhle Nr. 19 ist eine Chaityahalle. Auch die Felswände, die vor der Fassade eine Art Vorhof bilden, sind reich skulptiert. Im Inneren sind die Kapitelle und der Architrav mit Reliefs geschmückt. Das Gewölbe ahmt die Sparren einer Holzkonstruktion nach. Dem Stupa ist ein Relief mit stehender Buddhafigur vorgestellt.
- Höhle 19
.jpg.webp) Fassade
Fassade Blick auf den Stupa
Blick auf den Stupa Kapitelle und Architrav mit Reliefschmuck
Kapitelle und Architrav mit Reliefschmuck Buddhafeld im Architrav
Buddhafeld im Architrav Blick hinter den Stupa
Blick hinter den Stupa Fassade von innen
Fassade von innen Reliefs im Vorhof
Reliefs im Vorhof Reflieffelder seitlich rechts der Fassade
Reflieffelder seitlich rechts der Fassade Thronender Buddha in Vorhof
Thronender Buddha in Vorhof
Höhle 20
Höhle Nr. 20 in ein Vihara mit Veranda, Zentralraum, Kultbildraum mit Vorraum und zusätzlichem seitlichem Buddhabild an der Stirnwand und vier Zellen.
- Höhle 20
 Veranda mit Eingang
Veranda mit Eingang Durchblick zum Kultbildraum und seitlicher Buddhafigur
Durchblick zum Kultbildraum und seitlicher Buddhafigur Seitliche Buddhafigur
Seitliche Buddhafigur Blick durch den Vorraum zum Kultbildraum
Blick durch den Vorraum zum Kultbildraum Zelleneingang mit Supraportarelief
Zelleneingang mit Supraportarelief
Höhle 21
Höhle Nr. 21 ist ein Vihara mit Veranda, Säulenumgangsraum mit 12 Stützen, Kultbildraum mit Vorraum und seitlichen Vorräumen zu Zellen.
- Höhle 21
 Veranda mit Eingang
Veranda mit Eingang Seitenraum der Veranda
Seitenraum der Veranda Eingangsportal
Eingangsportal Durchblick zum Kultbildraum
Durchblick zum Kultbildraum Durchblick zu seitlichem Vorraum mit Zelleneingang
Durchblick zu seitlichem Vorraum mit Zelleneingang Malerei über Zelleneingang
Malerei über Zelleneingang Malerei an der Unterseite von Kapitellen und Unterzügen
Malerei an der Unterseite von Kapitellen und Unterzügen
Höhle 23
Höhle Nr. 23 ist ein Vihara mit Veranda, Säulenumgangsraum mit 12 Stützen, leerem Kultbildraum mit Vorraum, Seitenkapellen und 12 Zellen.
- Höhle 23
 Veranda mit Eingang
Veranda mit Eingang Eingangsportal
Eingangsportal Durchblick zum leeren Kultbildraum
Durchblick zum leeren Kultbildraum Blick aus dem Kultbildraum zum Eingang
Blick aus dem Kultbildraum zum Eingang Seitenkapelle mit Durchgang
Seitenkapelle mit Durchgang Kapitell
Kapitell Veranda mit Seitenraum
Veranda mit Seitenraum
Höhle 24
Höhle Nr. 24 sollte ein Vihara mit Veranda (fertiggestellt), Säulenumgangsraum und Kultbildraum mit Vorraum werden. Die Anlage blieb unvollendet und gibt eine Vorstellung vom Vorgehen der Baumeister.
- Höhle 24
 Veranda
Veranda Veranda mit Eingang
Veranda mit Eingang Durchblick zur Stirnwand
Durchblick zur Stirnwand Blick zur Seite
Blick zur Seite Blick in den Umgangsraum
Blick in den Umgangsraum
Höhle 26
Höhle Nr. 26 ist eine Chaityahalle mit prächtig ausgearbeiteter Fassade. Dem Stupa ist eine Buddhafigur vorgestellt. Kapitelle und Architrav sind reich skulptiert, im Umgang sind an den Seitenwänden großformatige Reliefs aus dem Leben des Buddha aus dem Fels gearbeitet. Das Gewölbe weist eine funktional nicht notwendige Sparrenstruktur auf, die auf (nicht erhaltene) Holzbauten verweist und einen dramatischen Wechsel von Hell und Dunkel bewirkt.
- Höhle 26
 Fassade
Fassade Eingangsportal
Eingangsportal Blick zum Stupa
Blick zum Stupa.jpg.webp) Thronende Buddhafigur vor dem Stupa
Thronende Buddhafigur vor dem Stupa Säulen, Architrav und Gewölbeansatz
Säulen, Architrav und Gewölbeansatz Relief im Umgang
Relief im Umgang Relief liegender Buddha in Umgang
Relief liegender Buddha in Umgang Buddharelief im Umgang
Buddharelief im Umgang
Tourismus

Trotz der Abgeschiedenheit Ajantas bedroht der Tourismus die teilweise etwa 2100 Jahre alten Malereien zunehmend; in einigen Höhlen wurden daher feste Barrieren installiert, um die Malereien vor häufig auftretender, mutwilliger Zerstörung zu schützen – außerdem wurden viele Gemälde mit Plexiglasscheiben gesichert. Zeitweise erhöhte Werte der Luftfeuchtigkeit, verursacht durch große Mengen von Besuchern in den Tempeln, haben die Deckenmalereien in einigen Höhlen bereits irreversibel beschädigt. Das Fotografieren mit Blitzlicht ist in den wenig beleuchteten Höhlen mittlerweile untersagt, um die Malereien vor weiterem Verfall zu schützen. Das Fotografieren mit Stativ ist ebenfalls untersagt.
Siehe auch
Literatur
- Simon P. M. Mackenzie: Adschanta: die geheiligten Höhlen Buddhas. Die Welt der Religionen. Herder, Freiburg i.Br./Basel/Wien 1983
- Amina Okada, Jean-Louis Nou: Ajanta. Frühbuddhistische Höhlentempel. Metamorphosis, München 1993
- Herbert Plaeschke und Ingeborg Plaeschke: Indische Felsentempel und Höhlenklöster. Köhler & Amelang, Leipzig 1982
- Bernd Rosenheim: Die Welt des Buddha. Frühe Stätten buddhistischer Kunst in Indien. Philipp von Zabern, Mainz 2006
- Benjamin Rowland: Malereien aus indischen Felsentempeln (Ajanta). Piper, München 1963 (Unesco Taschenbücher der Kunst).
- Dietrich Seckel: Kunst des Buddhismus. Werden, Wanderung und Wandlung. Holle, Baden-Baden 1962
- Walter M. Spink: Ajanta: History and Development. Reihe: Bertold Spuler (Hrsg.): Handbook of Oriental Studies. Section 2: South Asia. Volume 18/1–5. Brill, Leiden 2005–2008
Weblinks
- Ajanta-Höhlen – Fotos + Infos (englisch)
- Ajanta-Höhlen – Fotos + Infos (englisch)
- Ajanta-Höhlen – Fotos + Kurzinfos (englisch)
- Eintrag auf der Website des Welterbezentrums der UNESCO (englisch und französisch).
Einzelnachweise
- Herbert und Ingeborg Plaeschke: Indische Felsentempel und Höhlenklöster. Ajanta und Ellura. Wien, Köln, Graz: Böhlau 1983. S. 11 f.
.jpg.webp)