Feuerwehr in Schleswig-Holstein
Die Feuerwehr in Schleswig-Holstein bezeichnet die Gesamtheit der öffentlichen und privaten Feuerwehren in Schleswig-Holstein, ihre Aufgaben, Organisation, Ressourcen und Tätigkeiten. Gesetzliche Grundlage des Feuerwehrwesens in Schleswig-Holstein ist das Brandschutzgesetz (BrSchG).[1]
| Feuerwehr Schleswig-Holstein | |
 | |
| Notruf: 112 | |
| Personal | |
| Aktive (ohne Jugend): | 49.971 |
| Freiwilligenquote: | 97,8 % |
| Frauenquote: | 7,6 % |
| Jugendfeuerwehr: | 9491 |
| Stützpunkte | |
|---|---|
| Gesamtanzahl: | 1338 |
| Einsätze | |
| Gesamtanzahl: | 45.006 (inkl. Fehlalarme, ohne Notfalleinsätze und Krankentransporte) |
| Stand der Daten | 2013 |
Aufgaben und Organisation
Das Feuerwehrwesen umfasst nach dem schleswig-holsteinischen Brandschutzgesetz „die Bekämpfung von Bränden und den Schutz von Menschen und Sachen vor Brandschäden (abwehrender Brandschutz), die Hilfeleistung bei Not- und Unglücksfällen (technische Hilfe), die Verhütung von Bränden und Brandgefahren (vorbeugender Brandschutz, Mitwirkung der Feuerwehren bei Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung) und die Mitwirkung im Katastrophenschutz.“ Zuständige Oberbehörde ist das Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein mit dem in der Kommunalabteilung angesiedelten Referat „Feuerwehrwesen und Katastrophenschutz“.[2]
Neben den gesetzlichen Aufgaben übernehmen insbesondere die Freiwilligen Feuerwehren in den zahlreichen ländlichen Gemeinden Schleswig-Holsteins vielfältige Aufgaben des bürgerschaftlichen Engagements, etwa die Durchführung von oder Unterstützung bei öffentlichen Veranstaltungen oder bei der Jugendarbeit.
Arten und Zahl der Feuerwehren
Das Brandschutzgesetz unterscheidet für die öffentlichen Feuerwehren in Trägerschaft der Gemeinden die
- Berufsfeuerwehren mit hauptamtlichen Kräften und die
- Freiwilligen Feuerwehren und Pflichtfeuerwehren mit fast ausschließlich ehrenamtlichen Kräften.
Berufsfeuerwehren existieren in Schleswig-Holstein nur in den vier kreisfreien Städten Kiel (siehe auch Feuerwehr Kiel), Lübeck (siehe auch Feuerwehr Lübeck), Flensburg (siehe auch Feuerwehr Flensburg) und Neumünster.
In den übrigen mehr als 1100 Gemeinden gibt es Freiwillige Feuerwehren oder, in vier Fällen, Pflichtfeuerwehren (in Burg (Dithmarschen)[3], List auf Sylt[4], Friedrichstadt[5] und in Grömitz)[6][7]. Da einige Gemeinden mehrere Orts- oder Ortsteilfeuerwehren vorhalten (z. B. vier Feuerwehren im Gebiet der Stadt Norderstedt), gibt es in Schleswig-Holstein mehr Freiwillige Feuerwehren als Gemeinden. Die Größe der Freiwilligen Feuerwehren reicht von einer Löschgruppe mit einem Fahrzeug des Typs TSF bis hin zu Feuerwehren mit bis zu sieben Löschgruppen in zwei Zügen (z. B. in Elmshorn). Die Anzahl der Freiwilligen Feuerwehren ist seit Jahren rückläufig.
Neben den öffentlichen Feuerwehren gibt es weniger als 30 Werkfeuerwehren sowie einige Standorte der Bundeswehrfeuerwehr.
| Jahr | Berufsfeuerwehren | Freiwillige Feuerwehren | Jugendfeuerwehren | anerkannte Werk- und Betriebsfeuerwehren |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | 4 | 1.416 | 386 | 31 |
| 2005 | 4 | 1.414 | 397 | 27 |
| 2006 | 4 | 1.408 | 403 | 29 |
| 2007 | 4 | 1.406 | 406 | 29 |
| 2008 | 4 | 1.403 | 413 | 29 |
| 2009 | 4 | 1.397 | 416 | 28 |
| 2010 | 4 | 1.396 | 416 | 21 |
| 2011 | 4 | 1.386 | 417 | 26 |
| 2012 | 4 | 1.377 | 425 | 27 |
| 2013 | 4 | 1.371 | 429 | 27 |
Quelle: Jahresstatistik der Feuerwehren in Schleswig-Holstein („FEU 905“) des Innenministeriums Schleswig-Holstein[8]
Arten und Zahl der Feuerwehreinsätze
Seit Jahren machen die eigentlichen Brandeinsätze nur den kleineren Teil des Einsatzaufkommens aus, die Technische Hilfeleistung ist deutlich häufiger.
Notfalleinsätze und Krankentransporte fallen in Schleswig-Holstein ganz überwiegend bei den vier Berufsfeuerwehren an, die auch den Rettungsdienst abdecken. Im Bereich der Freiwilligen Feuerwehren ist das regelmäßig nicht der Fall. Allerdings sind bei vereinzelten Freiwilligen Feuerwehren First-Responder-Einheiten entstanden, die eventuelle Wartezeiten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes („Therapiefreies Intervall“) überbrücken und dann auch Notfalleinsätze bearbeiten können.[9]
| Jahr | Brände und Explosionen | Katastrophen- einsätze | Technische Hilfeleistungen | Tiere/ Insekten | Notfall- einsätze | Kranken- transporte | Sonstige Einsätze | Fehlalarme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 7.021 | 0 | 15.662 | 1.567 | 42.383 | 60.773 | 5.152 | 3.975 |
| 2005 | 7.235 | 0 | 14.574 | 960 | 39.105 | 56.562 | 5.483 | 3.558 |
| 2006 | 7.555 | 0 | 17.490 | 3.402 | 44.948 | 57.268 | 4.101 | 4.524 |
| 2007 | 7.102 | 0 | 17.934 | 1.598 | k. A. | k. A. | k. A. | 6.457 |
| 2008 | 7.296 | 1 | 16.473 | 1.556 | k. A. | k. A. | k. A. | 4.522 |
| 2009 | 7.132 | 0 | 14.680 | 1.637 | 59.181 | 60.778 | 4.138 | 4.300 |
| 2010 | 7.064 | 0 | 14.261 | 1.526 | 58.352 | 77.042 | 4.191 | 4.981 |
| 2011 | 8.296 | 0 | 15.399 | 1.440 | 64.097 | 60.773 | 3.621 | 5.111 |
| 2012 | 9.026 | 0 | 14.496 | in TH | 70.953 | 45.664 | 3.770 | 6.365 |
| 2013 | 10.533 | 528 | 23.049 | in TH | 55.201 | 56.523 | 5.296 | 6.407 |
Quelle: Jahresstatistik der Feuerwehren in Schleswig-Holstein („FEU 905“) des Innenministeriums Schleswig-Holstein[8]
Zuständigkeiten
Die Gemeinden müssen nach dem Brandschutzgesetz eine „leistungsfähige öffentliche Feuerwehr“ vorhalten. Die Kriterien für die personelle und technische Leistungsfähigkeit sind in einem Organisationserlass des Innenministeriums detailliert geregelt.[10] Mehrere amtsangehörige Gemeinden können die Aufgabe des Brandschutzes dem Amt übertragen.[11]
Die Kreise und kreisfreien Städte sind nach dem Gesetz verpflichtet, eine Einsatzleitstelle zu unterhalten und Alarmpläne für die gemeindeübergreifende Hilfe bereitzuhalten. Außerdem müssen die Kreise und kreisfreien Städte ein Informationssystem über gefährliche Stoffe und Güter vorhalten und einen „Löschzug Gefahrgut“ aufstellen. Die Kreise müssen darüber hinaus überörtliche Ausbildungslehrgänge anbieten und eine Feuerwehrtechnische Zentrale einrichten, in der Geräte geprüft und untergebracht und Lehrgänge abgehalten werden können. Außerdem sorgen die Kreise für die Aufstellung von Feuerwehrbereitschaften, in denen Einheiten aus mehreren Feuerwehren für größere Schadenslagen überörtlich zusammenarbeiten.[12]
Das Land Schleswig-Holstein ist, neben der „Förderung des Feuerwehrwesens“, gesetzlich unter anderem verpflichtet, eine Landesfeuerwehrschule zu unterhalten und den Gemeinden und Kreisen „für den abwehrenden Brandschutz und die technische Hilfe Zuwendungen zu gewähren“.[13] Praktisch werden diese Zuwendungen vor allem aus der Feuerschutzsteuer finanziert.[14]
Verbände
Die Gemeindefeuerwehren sind nach den Bestimmungen des § 13 BrSchG Pflichtmitglieder ihres Stadt- oder Kreisfeuerwehrverbandes. Diese sind Körperschaften des öffentlichen Rechts, an ihrer Spitze steht jeweils eine Stadt- bzw. Kreiswehrführung.
Die Stadt- und Kreisfeuerwehrbände sind zusammen mit anderen Organisationen Mitglieder im Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein e.V. An dessen Spitze steht als Verbandsvorsitzender der Landesbrandmeister. Der Landesfeuerwehrverband ist wiederum Mitglied im Deutschen Feuerwehrverband.
Unfallversicherung
Die Unfallversicherung („Feuerwehr-Unfallkasse“) der Feuerwehren ist die Hanseatische Feuerwehr-Unfallkasse Nord (HFUK Nord) mit Sitz in Kiel und weiteren Geschäftsstellen in Hamburg, Schwerin und Güstrow.
Feuerwehrmuseum

In Norderstedt besteht auf Initiative und mit Unterstützung des Fördervereins Feuerwehrmuseum Hof Lüdemann e.V. das Feuerwehrmuseum Schleswig-Holstein. Es zeigt historische Feuerwehrfahrzeuge und -geräte und gibt eine eigene Zeitschrift (Der Feuermelder) heraus.[15]
Personal
In den Feuerwehren in Schleswig-Holstein gab es 2013 knapp 50.000 Aktive, davon mehr als 48.000 in den Freiwilligen Feuerwehren, die übrigen in Berufs- und Werkfeuerwehren. Hinzu kommen knapp 15.000 Mitglieder in den Alters- und Ehrenabteilungen der Freiwilligen Feuerwehren und mehr als 9.000 Mitglieder der Jugendfeuerwehren. Insgesamt sind oder waren damit mehr als 74.000 Menschen in Schleswig-Holstein in der Feuerwehr aktiv, das entspricht rund 2,6 % der Gesamtbevölkerung. Hinzu kommt eine unbekannte Zahl fördernder Mitglieder in den Freiwilligen Feuerwehren.
Hauptamtliche und ehrenamtliche Kräfte
Die Aktiven in den Freiwilligen Feuerwehren sind fast ausschließlich ehrenamtlich tätig. Lediglich in einigen größeren Städten gibt es einen oder mehrere hauptamtliche Gerätewarte. In Norderstedt und am Industriestandort Brunsbüttel werden die Ehrenamtlichen darüber hinaus durch eine Hauptamtliche Wachabteilung ergänzt. Bei der Feuerwehr Elmshorn gibt es eine entsprechende Forderung zur Entlastung der freiwilligen Einsatzkräfte.[16] Die Mitglieder der hauptamtlichen Wachabteilung müssen eine der Berufsfeuerwehr entsprechende Qualifikation aufweisen. Personen, die nicht feuerwehrdiensttauglich sind, können seit 2015 in Verwaltungsabteilungen Dienst tun.
Die Zahl der Aktiven in den Freiwilligen Feuerwehren hat in den letzten Jahren insgesamt leicht abgenommen, allerdings ist die Zahl der weiblichen Aktiven in den letzten Jahren deutlich gestiegen, der Anteil nahm von 5,1 % (2004) auf 7,9 % (2013) zu. In den Berufs- und Werkfeuerwehren liegt der Anteil bei unter einem Prozent, bei den 9.491 Mitgliedern der Jugendfeuerwehr beträgt der Anteil weiblicher Mitglieder aber sogar 24 %.
| Jahr | Aktive in der Berufsfeuerwehr | Aktive in der Freiwilligen Feuerwehr | Aktive in der Werkfeuerwehr | Aktive in der Jugendfeuerwehr | Weibliche Aktive in der Freiwilligen Feuerwehr |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 704 | 49.026 | 1.097 | 9.456 | 2.496 |
| 2005 | 702 | 48.784 | 1.072 | 9.528 | 2.500 |
| 2006 | 688 | 48.758 | 1.103 | 9.407 | 2.546 |
| 2007 | 697 | 48.503 | 1.146 | 9.429 | 2.741 |
| 2008 | 717 | 48.863 | 1.144 | 9.515 | 2.907 |
| 2009 | 730 | 49.212 | 1.165 | 9.537 | 2.956 |
| 2010 | 734 | 49.314 | 827 | 9.568 | 3.097 |
| 2011 | 724 | 48.832 | 1.130 | 9.639 | 3.629 |
| 2012 | 747 | 48.369 | 1.028 | 9.166 | 3.648 |
| 2013 | 870 | 48.104 | 997 | 9.491 | 3.777 |
Quelle: Jahresstatistik der Feuerwehren in Schleswig-Holstein (FEU 905) des Innenministeriums Schleswig-Holstein[8]
Ausbildung
Die Ausbildung in den Feuerwehren in Schleswig-Holstein folgt wie in den anderen Bundesländern der Feuerwehr-Dienstvorschrift 2. Sie gliedert sich in eine Truppausbildung (Truppmann und Truppführerausbildung), die Führungsausbildung (Gruppenführung, Zugführung, Wehrführung, Verbandsführung) und die technische Ausbildung (z. B. Ausbildung zum Sprechfunker, (Fahrer-)Maschinisten, Motorsägenführer oder Atemschutzgeräteträger sowie weitergehende technische Ausbildung z. B. für die technische Hilfe, für Atemschutznotfälle etc.).
Grundausbildung
Die Grundausbildung besteht aus der praktischen Ausbildung in der Feuerwehr und dem Besuch von zwei Grundausbildungs-Lehrgängen (früher „Truppmann 1 und 2“, heute in der Regel „Feuerwehrgrundlehrgang“ oder ähnlich). Die praktische Ausbildung in der Feuerwehr soll inklusive der Lehrgänge mindestens 150 Stunden umfassen. Die weitere technische und Führungsausbildung erfolgt dann überwiegend in Form von Lehrgängen auf Kreis- oder Landesebene.
Ausbildung auf Kreisebene
Die Stadt- und Kreisfeuerwehrverbände führen die Lehrgänge zum Truppführer sowie die meisten technischen Lehrgänge mit ehrenamtlichem Personal durch. Diese Kreisausbilder sind in der Regel Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren, die für das jeweilige Thema eine besondere Befähigung haben.
Landesfeuerwehrschule
Das Land Schleswig-Holstein betreibt die Landesfeuerwehrschule Schleswig-Holstein in Harrislee. Dort werden für die Freiwilligen Feuerwehren die Führungslehrgänge (ab Gruppenführung) sowie die Ausbildungen für die Kreisausbilder mit hauptamtlichem Personal durchgeführt. Der Etat für laufende Kosten der Landesfeuerwehrschule betrug 2012 rund 2,7 Mio. Euro.[14]
Feuerwehrführerschein
Feuerwehrangehörige, die seit mindestens zwei Jahren im Besitz einer Fahrerlaubnis der Klasse B sind, können in Schleswig-Holstein nach einer theoretischen und praktischen Einweisung und einer Abschlussfahrt von mindestens 45 Minuten Dauer den sogenannten Feuerwehrführerschein für Einsatzfahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse von bis zu 7,5 Tonnen erhalten.[17] Die Einweisung, Prüfung und Ausstellung der Bescheinigung kann durch einen Feuerwehrangehörigen erfolgen, der das 30. Lebensjahr vollendet hat, seit mindestens fünf Jahren eine gültige Fahrerlaubnis der Klasse C1 besitzt und zum Zeitpunkt der Einweisungs- und Prüfungsfahrten im Verkehrszentralregister mit nicht mehr als drei Punkten belastet ist.[18]
Dienstgradsystem
Die Dienstgrade der Feuerwehr in Schleswig-Holstein werden in Abhängigkeit von Qualifikation, Funktion und Dienstzeit vergeben.
Nachwuchsförderung
Wesentliches Instrument der Nachwuchsförderung sind die mehr als 400 Jugendfeuerwehren mit annähernd 10.000 Aktiven. Die Jugendfeuerwehren stehen Kindern und Jugendlichen von 10 bis 17 Jahren offen.[19] Mit dem Jugendfeuerwehrzentrum in Rendsburg verfügen die Jugendfeuerwehren in Schleswig-Holstein über ein eigenes Ausbildungsgelände. Seit 2015 sind außerdem Kinderfeuerwehren für Kinder ab dem Alter von sechs Jahren gesetzlich zulässig.
Sportförderung
In den Berufsfeuerwehren und in einigen Freiwilligen Feuerwehren wird Sport als Teil des Feuerwehrdienstes durchgeführt, um auf die körperlichen Einsatz-Anforderungen (insbesondere unter Atemschutz) vorzubereiten. Die Hanseatische Feuerwehrunfallkasse unterstützt Freiwillige Feuerwehren in Schleswig-Holstein mit dem Projekt „Fit for Fire“ z. B. durch Anschubkurse und Trainerseminare.[20]
Technische Ressourcen
Fahrzeuge
Die Feuerwehren in Schleswig-Holstein verwenden überwiegend kleine Löschfahrzeuge. So waren 2013 mehr als 650 Tragkraftspritzenfahrzeuge sowie fast 500 Löschfahrzeuge der alten Norm LF 8 und LF 8/6 im Bestand. Größere Löschgruppenfahrzeuge (LF 16 und größer) waren demgegenüber in der Minderzahl.[8]
Insgesamt waren 2013 bei den Berufsfeuerwehren 317 Fahrzeuge mit Sprechfunk im Einsatz, bei den Freiwilligen Feuerwehren 2.559 (das entspricht durchschnittlich 1,9 Fahrzeugen je Freiwilliger Feuerwehr).[8]
Die Feuerfahrzeugarten sind mit einem Fahrzeugpunktwert belegt, der den grundsätzlichen taktischen Wert eines Fahrzeuges widerspiegelt. Diese Punktwerte müssen mit den Risikoklassen des Ausrückbereichs (Gemeinde oder Teil einer Gemeinde) korrespondieren: Der Risiko-Punktwert eines Ausrückebereichs muss von den dort vorhandenen Feuerwehrfahrzeugen mindestens erreicht werden.[21]
| Jahr | TSF | TSF-W | LF 8, LF 8/6 | LF 16, LF 16-TS | LF 16/12, LF 24, HLF | TLF | Hubrettung | Fahrzeuge mit Sprechfunk insgesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 578 | 196 | 630 | 197 | 138 | 372 | 67 | 3.340 |
| 2005 | 547 | 205 | 636 | 316 | 155 | 389 | 69 | 3.277 |
| 2006 | 506 | 244 | 632 | 310 | 169 | 382 | 69 | 3.402 |
| 2007 | 489 | 267 | 623 | 314 | 176 | 368 | 71 | 3.402 |
| 2008 | 469 | 280 | 616 | 323 | 189 | 351 | 70 | 3.440 |
| 2009 | 482 | 255 | 626 | 310 | 206 | 346 | 76 | 3.275 |
| 2010 | 405 | 324 | 587 | 323 | 233 | 295 | 72 | 3.241 |
| 2011 | 388 | 337 | 619 | 309 | 248 | 302 | 71 | 2.933 |
| 2012 | 361 | 331 | 509 | 193 | 190 | 259 | 68 | 3.075 |
| 2013 | 321 | 337 | 480 | 109 | 281 | 248 | 70 | 2.559 |
Entwicklung der Fahrzeugzahl bei den Freiwilligen Feuerwehren in Schleswig-Holstein
Quelle: Jahresstatistik der Feuerwehren in Schleswig-Holstein ("FEU 905") des Innenministeriums Schleswig-Holstein[8]
Leitstellen, Alarmierung und Funk
Die elf Kreise und vier kreisfreien Städte betreiben insgesamt sieben Leitstellen für Feuerwehr und Rettungsdienst, davon drei Integrierte Regionalleitstellen (kreisübergreifend) und zwei Kooperative Leitstellen (kreisübergreifend mit Einbeziehung der Polizei).
| Leitstelle | Standort | Abdeckung |
|---|---|---|
| Kooperative Leitstelle Nord | Harrislee | Stadt Flensburg, Kreise Schleswig-Flensburg und Nordfriesland |
| Kooperative Leitstelle West | Elmshorn | Kreise Pinneberg, Steinburg und Dithmarschen. Ab April 2021 auch Kreis Segeberg |
| Integrierte Regionalleitstelle Mitte | Kiel | Stadt Kiel, Kreise Rendsburg-Eckernförde und Plön |
| Integrierte Regionalleitstelle Süd | Bad Oldesloe | Kreise Stormarn, Herzogtum Lauenburg und Ostholstein |
| Integrierte Leitstelle Neumünster | Neumünster | Stadt Neumünster und angrenzende Gebiete der Kreise Plön, Segeberg, Rendsburg-Eckernförde und Steinburg[22] |
| Leitstelle Holstein (bis April 2021) | Norderstedt | Kreis Segeberg |
| Leitstelle Lübeck | Lübeck | Stadt Lübeck |
Die Alarmierung der rund 48.000 freiwilligen Einsatzkräfte erfolgt in knapp der Hälfte der Fälle (mehr als 23.000) per Meldeempfänger, sonst per Sirene.
Die Alarmierung und der Sprechfunkverkehr werden zurzeit auf Digitalfunk umgestellt. Das Innenministerium hat dazu eine Landeszentralstelle BOS-Digitalfunk eingerichtet.[23] Mit der Einführung des digitalen BOS-Sprechfunks werden auch die Funkrufnamen an die operativ-taktischen Adressen (OPTA) angepasst.
Software
Die Mehrzahl der Stadt- und Kreisfeuerwehrverbände (Städte Kiel, Flensburg, Lübeck, Neumünster sowie Kreise Ostholstein, Plön, Rendsburg-Eckernförde, Herzogtum Lauenburg, Stormarn, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Pinneberg) nutzt das Feuerwehrverwaltungsprogramm Fox-112.
Kleidung und Kennzeichnung
Die Dienst- und Einsatzkleidung ist in einer Dienstkleidungsvorschrift geregelt.[24]
Einsatzkleidung und Kennzeichnung
Die Einsatzschutzkleidung wird heute überwiegend in schwarz-blau getragen, orange-rote Schutzkleidung wird zunehmend ausgemustert. Einige Feuerwehren haben auch sand-/goldfarbige Kleidung (PBI-Material) eingeführt. Üblicherweise tragen die Einsatzkräfte ein Namensband an der Einsatzjacke. Dienstgrad-, Lehrgangs- oder Ehrenabzeichen werden hingegen nur an der sogenannten Dienstkleidung getragen.
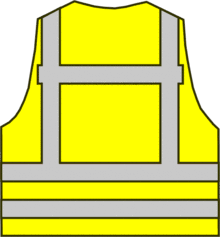
Die Funktionskennzeichnung an der Einsatzschutzkleidung erfolgt durch horizontale Streifen am Helm, verschiedenfarbige Koller und Kennzeichnungswesten sowie ggf. ergänzende Rückenschilder. Dabei tragen:
- Einsatzleiter eine gelbe Weste,
- Abschnittsleiter eine weiße Weste,
- „Führer einer angeforderten Einheit“ eine rote Weste,
- Kreis- oder Stadtwehrführer oder Leiter der Berufsfeuerwehr ein gelbes Koller und zwei rote Ringe am Helm,
- Amts- oder Gemeindewehrführer etc. ein weißes Koller und in der Regel einen roten Ring am Helm,
- Ortswehrführer und Zugführer ein rotes Koller und in der Regel zwei Streifen auf beiden Helmseiten,
- Gruppenführer eine blaue Weste und einen roten Streifen auf beiden Helmseiten,
- Fachberater eine grüne Weste,
- Feuerwehrseelsorger oder Mitarbeiter der Psychosozialen Notfallversorgung eine lilafarbene Weste,
- Atemschutzüberwacher eine schwarz-weiße Weste,
- Atemschutzgeräteträger den Buchstaben A am Helm (Kann-Bestimmung).
Dienstkleidung
An der Jacke der sogenannten Dienstkleidung (als „Ausgehuniform“ z. B. mit dem Dienstanzug der Bundeswehr vergleichbar) werden neben den Dienstgradabzeichen auch Lehrgangs- und Dienstzeitabzeichen sowie Orden und Ehrenzeichen (wie z. B. das Schleswig-Holsteinische Feuerwehr-Ehrenkreuz oder das Schleswig-Holsteinische Brandschutz-Ehrenzeichen), häufig in Form von Bandschnallen, getragen. In einigen, vor allem größeren Feuerwehren, sind auch Namensschilder üblich.
Siehe auch
Literatur
- Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein: Feuerwehren in Deutschland. Bd. 2: Schleswig-Holstein. Berlin: Huss, 2006, ISBN 978-3-341-01416-5
- Handlungskonzept der Feuerwehren des Landes Schleswig-Holstein. 2007. Online verfügbar (PDF)
- Clausen, Lars et al.: Entwicklung der Feuerwehr in Schleswig-Holstein: ein multidimensionaler Ansatz zur Analyse und Prognose der Entwicklung des Feuerwehrwesens einschließlich der Erarbeitung von Lösungsvorschlägen für den Erhalt der Freiwilligen Feuerwehr vor dem Hintergrund sich wandelnder, inhomogener Anforderungsprofile Gutachten herausgegeben vom Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein. Kiel, 1996
Weblinks
Einzelnachweise
- Gesetz über den Brandschutz und die Hilfeleistungen der Feuerwehren (Brandschutzgesetz - BrSchG) vom 10. Februar 1996
- Organisationsplan des Innenministeriums Schleswig-Holstein (Memento vom 24. März 2013 im Internet Archive) (PDF; 53 kB), Stand vom 2. Mai 2013
- Feuerwehren im Kreis Dithmarschen, zuletzt abgerufen am 14. Mai 2013
- "Die Feuerwehr List ist seit März 2005 eine Pflichtfeuerwehr", zuletzt abgerufen am 14. Mai 2013
- dpa, shz.de: Zu wenig Personal: Friedrichstadt zwingt 50 Bürger zum Dienst in der Feuerwehr | shz.de. In: shz. Abgerufen am 21. April 2016 (deutsch).
- Zu kleine Feuerwehr, in Grömitz wird Löschen Pflicht auf der Seite des NDR
- Pflichtfeuerwehr in Grömitz sucht Kameraden auf der Seite des NDR
- Jahresstatistik der Feuerwehren in Schleswig-Holstein („FEU 905“) des Innenministeriums Schleswig-Holstein, 2013 mit dem Hinweis, dass durch eine „Änderung der Erfassungsmodalitäten“ Abweichungen der Zahlen vom Vorjahr möglich seien.
- zum Beispiel in Dänischenhagen, („Spezialeinheit bereit für den Einsatz“, Newsletter des Landesfeuerwehrverbandes Schleswig-Holstein, Ausgabe 15, vom 7. August 2015, S. 9) oder Glückstadt
- Organisation und Ausrüstung der Freiwilligen Feuerwehren, Pflichtfeuerwehren und Werkfeuerwehren sowie die Laufbahnen und die Ausbildung ihrer Mitglieder. Erlass vom 7. Juli 2009
- §5, Punkt 10 der Amtsordnung vom 28. Februar 2003
- Einführung der Gliederung für Feuerwehrbereitschaften. Erlass vom 19. Mai 2008
- Grundlage sind die Richtlinien zur Förderung des Feuerwehrwesens in Schleswig-Holstein vom 8. Dezember 2010
- Aufteilung der Feuerschutzsteuer im Finanzausgleichsjahr 2012 (Memento vom 19. Februar 2015 im Internet Archive)
- Feuerwehrmuseum Schleswig-Holstein
- Hilferuf: Wehr fordert Verstärkung, Elmshorner Nachrichten online vom 2. März 2011
- Landesverordnung über die Erteilung von Fahrberechtigungen an ehrenamtlich tätige Angehörige der Freiwilligen Feuerwehren, der anerkannten Rettungsdienste, des Technischen Hilfswerks und sonstiger Einheiten des Katastrophenschutzes (Fahrberechtigungsverordnung - FahrbVO), vom 15. September 2011
- Zusammenfassung des Informationstages zum Erwerb der Fahrberechtigung für ehrenamtlich tätige Angehörige der Freiwilligen Feuerwehren, der anerkannten Rettungsdienste, des Technischen Hilfswerks und der Einheiten im Katastrophenschutzes vom 13. September 2011
- Jugendfeuerwehr im Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein e.V.
- Fit for Fire-projekt der HFUK Nord (Memento vom 27. September 2013 im Internet Archive), abgerufen am 25. September 2013
- Anlage 1 zum Organisationserlasse Feuerwehren, OrgFw, des Landes Schleswig-Holstein
- Integrierte Leitstelle Neumünster, abgerufen am 2. Mai 2020
- Landeszentralstelle für den BOS-Digitalfunk
- Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein – Landesfeuerwehrschule: Dienstkleidungsvorschrift für die Feuerwehren im Lande Schleswig-Holstein (Memento vom 8. Juli 2013 im Internet Archive) vom 4. September 2008. Gemäß Bekanntmachung des Innenministeriums vom 13. November 2013 (Amtsbl. Schl.-H. 2013, S. 969) wurde die Geltungsdauer bis zum 31. Dezember 2018 verlängert.