Berliner Schlittschuhclub
Der Berliner Schlittschuh-Club (kurz BSchC) ist ein Sportverein aus Berlin.

Die Eishockeyabteilung ist mit insgesamt 19 Titeln Deutscher Eishockey-Rekordmeister (1912–1914, 1920, 1921, 1923–1926, 1928–1933, 1936, 1937, 1974 und 1976) und wurde fünfmal Vizemeister (1922, 1939, 1940, 1975 und 1978). Die 2007 ausgeschlossene Eishockeyabteilung gründete den neuen Verein Eissport und Schlittschuh-Club 2007 Berlin, der 2020 seinen Namen in Berliner Schlittschuh-Club änderte. Präsident ist zurzeit Karsten Dallmann.
Geschichte
Der BSchC wurde 1893 gegründet. Da seit Ende des Zweiten Weltkriegs das eigene Vereinsgelände zunächst nicht mehr und in der Folgezeit nur noch eingeschränkt zur Verfügung stand, zog der Verein 1974 wieder auf das heutige Vereinsgelände an der Glockenturmstrasse in Berlin um.
1902 nahm der BSchC Eishockey nach Bandy-Regeln auf.[1] Auf Anhieb bildeten sich zwei Herren- und eine Damenmannschaft, die im Sommer auch Land-Hockey spielten.
Die Jahre bis zur ersten Meisterschaft


1908 wurde der Eishockeyspielbetrieb nach kanadischen Regeln im Berliner Schlittschuh-Club aufgenommen. Im November 1908 bestritt der BSchC sein erstes offizielles Eishockeyspiel im Rahmen des internationalen Eishockeyturniers im Berliner Eispalast an der Lutherstraße, welches durch den Schlittschuh-Club ausgetragen wurde. Erster Gegner der Mannschaft war der SC Charlottenburg, der mit 13:0 Toren bezwungen wurde. 1910 und 1911 erreichte die Mannschaft zweimal in Folge das Finale um die Berliner Stadtmeisterschaft und unterlag jeweils dem BFC Preussen. 1912 wurde der Verein erstmals Deutscher Meister. In den folgenden Jahrzehnten kamen 19 weitere Meisterschaften hinzu, eine davon in einer Kriegsspielgemeinschaft mit dem SC Brandenburg.
Auch international war der Berliner SC aktiv. Beim Eishockeyturnier in Brüssel 1910 wurde man Zweiter, 1911 Dritter. Beim Coupe de Chamonix erreichte man bei vier Teilnahmen zwischen 1910 und 1914 drei Mal den zweiten Platz, einmal den dritten Platz. Bei der ersten Europameisterschaft 1910 vertrat der Berliner SC Deutschland und wurde Zweiter; in den Folgejahren stellte die Mannschaft des Berliner SC den Hauptteil der Deutschen Nationalmannschaft. 1912 bis 1914 war man deutscher Vertreter bei der LIHG-Meisterschaft, die man 1912 und 1913 gewinnen konnte, 1914 reichte es zum zweiten Platz. Die Eishockeyturnier in Les Avants 1911 und 1914 schloss man jeweils als Zweiter ab. Den Ringhoffer-Pokal in Prag gewann man bei allen drei Austragungen 1913, 1914 und 1922.
Die Nachkriegsjahre bis Ende der 1960er Jahre
In der Nachkriegszeit nach dem Zweiten Weltkrieg spielte die Mannschaft des BSchC zunächst unter dem Namen EG Berlin-Eichkamp, da der Verein erst 1951 wieder unter seinem ursprünglichen Namen ins Vereinsregister eingetragen werden durfte. Als EG Berlin-Eichkamp gewann der Verein 1947 die Deutsche Vizemeisterschaft sowie 1949 den Meistertitel des Berliner Eissportverbandes. In den Qualifikationsspielen zur Oberliga 1949/50 scheiterte der Schlittschuhclub jedoch am SC München. Mit der erneuten Berliner Meisterschaft 1950 qualifizierte man sich für die aufgestockte Oberliga 1950/51, die man nach einer Abstockung jedoch nach einem Jahr wieder verließ.
In der Saison 1957/58 gelang dem Verein der erneute Aufstieg in die nun zweitklassige Oberliga. In der Oberliga verblieb der BSchC bis auf ein kurzes Zwischenspiel in der Bundesligasaison 1966/67 und der Saison 1969/70 nach einem freiwilligen Rückzug in der Regionalliga, bevor sich der Verein ab der Spielzeit 1972/73 im Eishockey-Oberhaus etablierte.[2]
Anfang der 1970er bis Ende der 1980er

Im Sommer 1971 wurden in Berlin die Eishockeymannschaften von BFC Preussen und Hertha BSC aufgelöst, sodass die bisherigen Führungsspieler dieser Mannschaften den Kader des BSC verstärkten. Sowohl in der Saison 1973/74, als auch der Saison 1975/76 wurde der Club mit dem Trainer Xaver Unsinn Deutscher Meister. Herausragende Spieler waren z. B. Lorenz Funk sr. und die Vozar-Brüder. Im Jahr 1981 wurde die Eishockeyabteilung schließlich in den Berliner Schlittschuh-Club Eishockey e. V. ausgegliedert, was aber nicht den Rückzug aus der Eishockey-Bundesliga 1982 aufgrund finanzieller Schwierigkeiten verhinderte. Aus Teilen der zurückgezogenen Mannschaft bildete sich im Anschluss der BSC Preussen. 1983 nahm der BSchC den Spielbetrieb in der Regionalliga Nord wieder auf und spielte ab 1984 bis zur Auflösung der Mannschaft 1987 in der Oberliga Nord.
Frauenmannschaft
Im Jahr 1983 wurde das Angebot im Eishockeybereich um eine Frauenmannschaft erweitert, die sich im Jahr 1988 dem OSC Berlin anschloss.
Die 1990er Jahre
Nach dem 1991 erfolgten Beitritt der Ost-Berliner Eishockeymannschaft des Berliner SV AdW, die 1990/91 als Teilnehmer an der letzten Bestenermittlung in der DDR in die Regionalliga Nord aufgenommen wurde, übernahm der Schlittschuh-Club die Einstufung des BSV AdW in der Regionalliga Nord. Nachdem 1992 die Eishockeyabteilung in den wiederbelebten Berliner Schlittschuh-Club Eishockey ausgelagert wurde, spielte sie bis zur Saison 1993/94 wieder in der Oberliga Nord. 1996 stieg der Verein sogar für eine Spielzeit in die 2. Liga Nord auf. In der Folgezeit wurde der BSchC Eishockey wieder in den Hauptverein eingegliedert.
Im Jahr 2004 schloss der Berliner Schlittschuh-Club nach der Insolvenz der Berlin Capitals eine Kooperation mit der neu gegründeten Berliner Schlittschuh-Club Preussen GmbH (Siehe BSchC Preussen), die jedoch nach der Insolvenz des BSchC Preussen 2005 nach einem Jahr beendet wurde. Wie in der Saison 2005/06 spielte die erste Herrenmannschaft des BSchC bis 2007 in der fünftklassigen Verbandsliga Nord-Ost, die zweite Auswahl trat in der sechstklassigen Landesliga Berlin an.
Der ESC Berlin 2007
Anfang Juli 2007 wurde die Eishockeyabteilung vom Verein Berliner Schlittschuh-Club 1893 ausgeschlossen. Um den Mitgliedern der ausgeschlossenen Abteilung die Fortführung des Spielbetriebs zu ermöglichen, wurde ein neuer Verein, der Berliner Schlittschuh-Club 2007 Eissport, später Eissport- und Schlittschuhclub (ESC) Berlin gegründet. Der ESC spielte 2007/08 eine Saison in der Regionalliga. Nachdem der Club in die fünftklassige Berliner Landesliga abstieg, wurde zeitgleich eine Mannschaft in der Sachsenliga gemeldet, die 2010 durch eine Ligenreform zur vierthöchsten Spielklasse wurde und im Folgejahr in Regionalliga Ost umbenannt wurde. Highlight im Jahr 2010 war ein Ligaspiel des Clubs in der O2 World vor über 1000 Zuschauern. 2018 zog sich der Club aus der Regionalliga in die Landesliga zurück.
Neustart 2020
Am 17. Juli 2020 änderte die Mitgliederversammlung den Namen des ESC Berlin in Berliner Schlittschuh-Club.[3] Die zweite Mannschaft des insolventen ECC Preussen Berlin wechselte komplett zum BSchC, über die Übernahme der Regionalligamannschaft wird noch verhandelt.
Erfolge
Deutscher Meister
Der Berliner Schlittschuh-Club Rekordmeister im deutschen Eishockey. Er erreichte 19 Deutsche Meisterschaften sowie 1944 eine Meisterschaft in einer Kriegsspielgemeinschaft mit dem SC Brandenburg.
- Sieger 1912, 1913, 1914, 1920, 1921, 1923, 1924, 1925, 1926, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1936, 1937, 1974, 1976
- Sieger in KSG mit dem SC Brandenburg 1944
Spengler Cup
Der Schlittschuhclub ist die erfolgreichste deutsche Mannschaft des renommieren internationalen Spengler Cups.
- Sieger 1924, 1926, 1928
Internationale Österreichische Meisterschaft
Der Schlittschuhclub gewann alle drei Austragungen des Ringhofferpokals:
- Sieger 1913, 1914, 1922
LIHG-Meisterschaft
Der Berliner Schlittschuh-Club vertrat Deutschland bei der zeitgenössisch als Weltmeisterschaft bezeichneten LIHG-Meisterschaft.
- Sieger 1913, 1914
Berliner Meister
- Sieger 1910, 1913, 1914, 1921, 1923, 1928, 1930, 1932, 1933, 1934, 1935, 1937, 1938, 1940, 1947 (als SG Eichkamp), 1949, 1950, 1954, 1955, 1957
Bekannte ehemalige Spieler
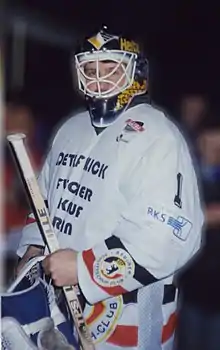
- vor 1945
- 1970–1980
- Manfred Müller
- Franz Funk
- Lorenz Funk senior
- Ernst Köpf
- Martin Hinterstocker senior
- Stefan Metz
- 1980–1990
- Michael Müller
- Gregor Batora
- Thomas Böhm
- Klaus Poguntke
- seit den 1990er-Jahren
- René Bielke
- Dietmar Peters
- Andreas Gensel
- Harald Kuhnke
- Jörg Döhler
- seit 2000
Bekannte ehemalige Trainer
- Xaver Unsinn (Deutscher Meister 1974, 1976)
- Olle Öst
Siehe auch
Einzelnachweise
- Neue Hamburger Zeitung - 1902-02-05. Abgerufen am 3. März 2021 (deutsch).
- I-bi Che - uuh. In: Der Spiegel. Nr. 4, 1974 (online).
- Eissport und Schlittschuh-Club Berlin - Home. Abgerufen am 20. Juli 2020 (deutsch).