Michael Wewerka
Michael J. Wewerka (* September 1938 in Berlin-Spandau) ist ein deutscher Autor und Galerist; bekannt ist er als Förderer vor allem der Kunstrichtung Fluxus. Die breite Öffentlichkeit kennt Michael Wewerka als Initiator und Betreiber des ältesten Berliner Trödel- und Kunstmarkts an der Straße des 17. Juni.[1]
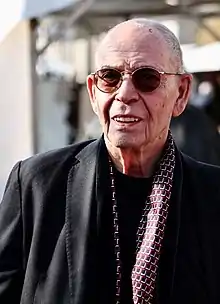
Leben
Nach Besuch der Volksschule am Mierendorffplatz in Charlottenburg arbeitete Michael Wewerka zunächst als Tankwart, Autoschlosser, Taxi- sowie internationaler Reisebusfahrer. In Abendkursen, während seiner Zeit in einer Berliner Kommune, erlangte er die allgemeine Hochschulreife und studierte von 1965 bis 1971 Publizistik, schloss das Studium jedoch nicht ab.
Bereits zu dieser Zeit handelte Wewerka mit antikem Trödel des West-Berliner Sperrmülls auf dem 1967 vom Aktionskünstler Reinhard Schamuhn gegründeten ersten deutschen Flohmarkt in Hannover.
Der hannoversche Flohmarkt wurde für Wewerka zum Impulsgeber, ein ähnliches Projekt in West-Berlin zu versuchen. Nach anfänglichen Bedenken gab das Wirtschaftsamt nach, und Wewerka gründete 1973 den Berliner Antik- und Trödelmarkt auf dem Klausenerplatz. Fünf Jahren später wurde der Standort an das Charlottenburger Tor auf der Straße des 17. Juni verlegt und der Flohmarkt ab 1988 um einen Kunst- und Kunsthandwerkermarkt erweitert.[2]
Tätigkeit
Bereits während seines Studiums interessierte sich Wewerka für experimentelle Kunstformen, extravagante Happenings, Performances, vor allem die Stilrichtung Dadaismus und die Fluxus-Bewegung als dessen Weiterentwicklung.
Die Einnahmen aus dem Trödelgeschäft ermöglichten wirtschaftliche Unabhängigkeit, und ab Mitte der 1970er Jahre engagierte sich Michael J. Wewerka als Galerist und Kunstvermittler.[3] Zudem begann er, Drehbücher zu schreiben und als Filmregisseur zu arbeiten. Nach dem Debakel des als Antigewaltfilm konzipierten Kinoprojektes Werwölfe (1972), das in der Rezeption komplett gegenteilig beurteilt und indiziert wurde,[4] folgten Kurzfilme wie Puppen, Pötte und Moneten (1977),[5] Die Begegnung im Tal (1979), Der Fremde mit dem Ring (1982) und Werbespots.
Danach widmete sich Wewerka wieder verstärkt dem Kunst- und Trödelmarkt am Ernst-Reuter-Haus und seinen Galerien. Hervorzuhebende Ausstellungen und Veranstaltungen waren z. B. im Mai 1983: Die Verfolgung des Geistes 1933 bis 1983, anlässlich des 50. Jahrestags der Bücherverbrennung 1933 in Deutschland, u. a. mit Breyten Breytenbach, Marianne Frisch, Lew Kopelew, Milan Kundera, und Ende desselben Jahres der Workshop: Unverstand hat Gold im Mund, u. a. mit Elfriede Jelinek, Elfi Mikesch, Ulrike Ottinger, Oskar Pastior, oder 1986 in Hannover: Teile – konzeptionelle Arbeiten mit Raffael Rheinsberg und Die Wege des Kurt Schwitters, Aufführungen von Eberhard Blum, John Cage, Schwitters und Emmett Williams. Hierzu, bis 1989, hatte Wewerka seine Berliner Galerien um einen Standort im KUBUS in der niedersächsischen Hauptstadt erweitert. Zudem eröffnete er einen Ausstellungsraum im spanischen Malpartida de Cáceres, wo sein Freund Wolf Vostell mit Ehefrau Mercedes das Museo Vostell Malpartida führten.
Ab 1988 beteiligte Wewerka die Kunsthistorikerin Barbara Weiss an seiner Berliner Galerie, und obwohl er argumentierte, dass private Galerien für Gegenwartskunst vor allem Mäzenatentum bedeute, hielt er daran fest, weniger bekannte Künstler und Künstlerinnen der Postmoderne aufzubauen, ihnen mit Räumlichkeiten für Performance-Aktionen, mit Ausstellungen, Lesungen und Katalogen eine breitere Öffentlichkeit zu verschaffen. Zudem engagierte er sich als deren Sammler und Förderer.[6]
Zu den von Wewerka ausgestellten Künstlerinnen und Künstlern gehörten u. a. Jim Avignon, Betty Stürmer, Gio di Sera, Dag, Guillaume Bijl, Guy van Bossche, Kazuo Katase, Tobias Lehner, Koichi Ono, Bernd Schwarting, kurz vor dessen Tod noch Al Hansen[7][8] und auch postum weiterhin Wolf Vostell.[9]
Die zur Avantgarde in der Bildenden Kunst und Postmoderne oftmals gestellte Frage: Was ist Kunst? beantwortet Michael Wewerka schlicht mit „Alles was der Künstler dafür erklärt, ist Kunst…“, aber fügt im Sinne von Marcel Duchamp, der Betrachter vervollständigt das Kunstwerk, hinzu: „doch genauso wichtig ist, dass die Gesellschaft sie als Kunst annimmt.“[10] Im Jahr 2014, unter dem Titel Kostbarkeiten aus der Sammlung M. J. Wewerka, widmete das Potsdamer Museum Fluxus Plus ihm eine umfangreiche Ausstellung.[11]
Zusammen mit Georg Nothelfer und Eva Poll ist Wewerka Ehrenpräsident des Landesverband Berliner Galerien e.V.;[12] neben seinen Aktivitäten als Galerist und Veranstalter verfasste er Gedichte, Aphorismen und Kurzgeschichten. Wolf Vostell kommentiert auf dem rückseitigen Buchdeckel von Eine lange Zeit: „Ich liebe diese Gedichte, weil die letzten Sätze mich immer in Trance versetzen.“ Und Manfred Eichel formuliert an gleicher Stelle: „Michael Wewerka ist ein besorgter, aber auch amüsierter Kommentator unserer Zeit – sprachlich brillant, gedanklich immer wieder verblüffend, lakonisch und zynisch und voller Bilder, die sich in den Köpfen der Leser weiterspinnen.“
Lesungen aus Wewerkas Büchern finden in Berlin, Brandenburg an der Havel, Potsdam, Prag und anderswo statt. Er trägt selbst vor oder es lesen Künstlerfreunde, Schauspieler.[13]
Wewerka lebt zusammen mit seiner Ehefrau Olga im Berliner Ortsteil Niederschönhausen.
Bibliografie (Auswahl)
- Eine lange Zeit – Aphorismen, Gedichte, Geschichte. Michael Wewerka, Zeichnungen: Wolfgang Nieblich, 162 S., PalmArtPress Verlag, 2016, ISBN 978-3-941524-80-4.
- Cas zralosti - Aus dem Sand der Phantasie. Michael Wewerka Gedichtband (deutsch und tschechisch), Zeitungsbeilage 2014.
- Ausstellung: die Galerie – Geschichte der Galerie Wewerka Berlin. Amnon Barzel, Thomas Wulffen u. a., Hrsg. Klara Wallner, Michael J. Wewerka, Verlag Ars Nicolai, Berlin 1996, ISBN 3-87584-992-2.
- La muerte de Fenix. Lyrik von Michael Wewerka, Edition Wewerka, Malpartida (Spanien) 1992
- Wolf Vostell – die Nackten und die Toten. Verlagsgemeinschaft Edition Ars Viva und Edition Wewerka, Berlin 1983, ISBN 3-923466-58-3.
- Jo Hagège. Michael Wewerka (Hrsg.), Edition Wewerka, Berlin 1982.
- Tropfen auf den heißen Stein – Gedichte. Michael Wewerka, Edition Ars Viva Berlin, 1981.
- Gefährliche Töne: Gedichte. Michael Wewerka, Zeichnungen: Wolfgang Nieblich, H. Schmid Verlag, Berlin 1981, ISBN 3-922880-00-2.
Ausstellungen, Lesungen (Auswahl)
- 2018 Ein Altmeister mit vielen Facetten, Münchberg (kueko-fichtelgebirge.de)
- 2017 Eine lange Zeit, Prager Literaturhaus, Prag, Tschechien (prager-literaturhaus.com)
- 2017 Harmonie der Gegensätze, Kunsthalle Brennabor, Brandenburg, (maz-online.de)
- 2014 Kostbarkeiten aus der Sammlung M. J. Wewerka, Museum FLUXUS plus, Potsdam (art-in-berlin.de)
- 2007 Geburtstagsausstellung Wolf Vostell, Galerie M. J. Wewerka, Berlin (morgenpost.de)
- 2001 Blickachsen IV, Stiftung Blickachsen, Bad Homburg v. d. Höhe, (blickachsen.de)
- 1996 Jubiläumsausstellung, Kunstforum, Kulturbrauerei, Berlin (kunstforum.de)
- 1995 Wewerka: Guillaume Beijl, Manfred Schlings, Wolf Vostell, Katzuo Katase, Kunsthalle Ostseebad Kühlungsborn (kunsthalle-kuehlungsborn.de)
- 1995 Al Hansen – Paper Dolls and others, Performance in der Homeyerstraße, Berlin
- 1991 Martin Kippenberger, William Holden Company – The Hot Tour, Wewerka & Weiss Galerie
- 1987 Burning Mind Projects, Milan Knížák, Galerie Michael Wewerka im KUBUS. Städtische Galerie, Hannover
- 1986 Pinturas, Wolf Vostell, Wewerka Galerie Malpartida, Spanien
- 1986 Teile – konzeptionelle Arbeiten, Raffael Rheinsberg, Wewerka Galerie, Berlin
- 1986 Die Wege des Kurt Schwitters, Galerie Michael Wewerka im KUBUS. Städtische Galerie, Hannover
- 1984 Sprachen der Kunst, Wewerka Galerie in der Akademie der Künste, Berlin
- 1983 Die Verfolgung des Geistes – 1933 bis 1983, Wewerka Galerie Berlin
- 1983 Unverstand hat Gold im Mund, Wewerka Galerie Berlin
- 1976 Ölbilder – Informel, Peter Schubert, Eberhard Blum spricht die Ursonate von Kurt Schwitters, Wewerka Galerie Berlin
- 1974 Moderne Grafik, u.a. Rafael Canogar, Robert Filliou, Lienhard von Monkiewitsch, Günther Uecker, Karl Vogelsang, Stefan Wewerka, Galerie Wewerka, Schloßstrasse, Berlin
- 1974 Naive Winterbilder, Josef Wittlich, Galerie Wewerka, Schloßstrasse, Berlin
Weblinks
Einzelnachweise
- 40 Jahre Trödelmarkt: Brillantring für einen Euro. In: Berliner Zeitung. 31. März 2014, abgerufen am 18. Februar 2022.
- Der Trödeltrupp – Das Geld liegt im Keller: Ausmisten, Platz machen und auch noch Geld verdienen. FinanzBuch Verlag, 16. April 2018, abgerufen am 24. Februar 2022.
- Reich getrödelt. In: Berliner Zeitung. 23. März 2014, abgerufen am 16. Februar 2022.
- Werwölfe. In: Filmdienst. Abgerufen am 16. Februar 2022.
- Puppen, Pötte und Moneten. Bundesarchiv, abgerufen am 20. Februar 2022.
- Wenn ich mich über mein Leben beklagen würde, wäre das Blasphemie. In: KUNSTFORUM International, Bd. 134, Art & Pop & Crossover. Abgerufen am 16. Februar 2022.
- Ich war immer ein Einzelgänger. In: taz. 4. Dezember 1999, abgerufen am 19. Februar 2022.
- Zurück zu den Wurzeln. In: Der Tagesspiegel. 25. Oktober 2005, abgerufen am 19. Februar 2022.
- Geburtstagsausstellung für Wolf Vostell. In: Berliner Morgenpost. 26. Oktober 2007, abgerufen am 16. Februar 2022.
- Elmar Schwenke: Die Verarschungsgesellschaft: Wie wir verraten und verkauft werden. In: neobooks. 28. August 2014, abgerufen am 17. Februar 2022.
- Das Leben als Musik begreifen. In: Potsdamer Neueste Nachrichten. 31. Juli 2014, abgerufen am 16. Februar 2022.
- Anerkennungspreise. Berliner Galerien, abgerufen am 2. März 2022.
- Kunstkalender Berliner Galerien. Berliner Galerien, abgerufen am 16. Februar 2022.