Charlotte von Mahlsdorf
Charlotte von Mahlsdorf (mit bürgerlichem Namen Lothar Berfelde)[1][2] (* 18. März 1928 in Berlin-Mahlsdorf; † 30. April 2002 in Berlin) war die Gründerin und langjährige Leiterin des Gründerzeitmuseums in Berlin-Mahlsdorf und eine berühmte Trans-Frau in Deutschland.[3][1][4][5]
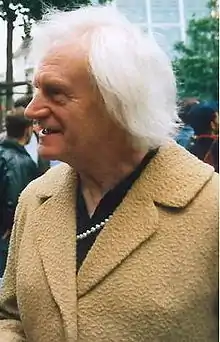
Leben
Kindheit und Jugend
Charlotte von Mahlsdorf wurde als Sohn von Max und Gretchen (geb. Gaupp) Berfelde geboren und Lothar genannt, hatte zwei Geschwister,[6] interessierte sich laut autobiographischen Aussagen bereits als Kind für Mädchenkleider und „alten Kram“, fühlte sich als Mädchen, begann 13-jährig, dem Kreuzberger Trödelhändler Max Bier beim Ausräumen von Wohnungen zu helfen, und erwarb dabei vom Lohn einzelne Stücke für sich selbst.
Der Vater war Ende der 1920er Jahre in die NSDAP eingetreten. Zeitweise war er politischer Leiter in Mahlsdorf. 1942 drängte er Lothar – seinen Sohn, der sich gar nicht als Junge fühlte – zum Eintritt in die Hitlerjugend. Zwischen beiden gab es oft Streit, der eskalierte, nachdem die Mutter 1944 die Familie verlassen hatte. Der Vater forderte Lothar auf, sich für einen Elternteil zu entscheiden, und drohte mit seinem Dienstrevolver. Infolgedessen erschlug Lothar den Vater mit einem Nudelholz im Schlaf. Nachdem er einige Wochen in der Psychiatrie zugebracht hatte, wurde er im Januar 1945 von einem Berliner Gericht als „asozialer Jugendlicher“ zu vier Jahren Jugendgefängnis verurteilt.
Nach 1945
Mit dem Ende der NS-Herrschaft kam Lothar frei, arbeitete als Trödler und kleidete sich weiblicher. Aus „Lothar“ wurde „Lottchen“, sie liebte Männer und wurde später zur stadtbekannten Figur „Charlotte von Mahlsdorf“ (ab 1994 ihr offizieller Künstlername).[7] Sie begann, Haushaltsgegenstände zu sammeln, rettete so aus zerbombten Häusern verschiedene historische Alltagsgegenstände und lebte vom Verkauf von Möbeln.

Von 1946 bis 1948 bewahrte sie das verwaiste Schloss Friedrichsfelde vor Vandalismus, indem sie dort mit ihrer Sammlung einzog, Instandsetzungsarbeiten am Schloss durchführte, Flüchtlinge und Vertriebene aufnahm und Führungen veranstaltete.[8]
Aus der Sammlung entstand 1959/60 das „Gründerzeitmuseum“: Sie setzte sich für den Erhalt des vom Abriss bedrohten Gutshauses Mahlsdorf ein und erhielt das komplette Gebäude mietfrei überlassen. 1960 eröffnete sie in dem erst teilrekonstruierten Haus ihr Museum von Alltagsgegenständen der Gründerzeit. Die Mulackritze – die letzte komplett erhaltene Berliner Kneipe aus dem Scheunenviertel – rettete sie beim Abriss des Gebäudes 1963 und richtete sie im Keller des Museums wieder im Originalzustand ein. Diese erlangte Bekanntschaft in Film-, Künstler- und Schwulenkreisen; ab 1974 fanden dort Treffen und Feiern der Homosexuellen Interessengemeinschaft Berlins (HIB) statt. 1972 wurde das Gutshaus unter Denkmalschutz gestellt. 1974 kündigten DDR-Behörden an, das Museum mit den Ausstellungsstücken zu verstaatlichen, worauf Charlotte von Mahlsdorf begann, ihren Besitz an die Besucher zu verschenken.

Durch das Engagement der Schauspielerin Annekathrin Bürger und des Rechtsanwalts Friedrich Karl Kaul (und möglicherweise auch durch die Verpflichtung als Inoffizieller Mitarbeiter des MfS) konnte die Aktion jedoch 1976 beendet werden, und Charlotte durfte das Museum behalten.
Im Jahr 1989 hatte sie einen Gastauftritt als "Bardame" in dem Film Coming Out von Heiner Carow.
Umzug nach Schweden
1991 überfielen Neonazis eines ihrer Feste auf dem Gutshof und verletzten mehrere Teilnehmer. Zu dieser Zeit kündigte sie Überlegungen an, Deutschland zu verlassen. 1992 erhielt sie das Bundesverdienstkreuz. Der Entschluss, Deutschland zu verlassen, sorgte dafür, dass sie 1995 das letzte Mal Besucher durch das Gründerzeitmuseum führte und 1997 nach Porla Brunn in Schweden umsiedelte. Dort eröffnete sie ein neues Jahrhundertwendemuseum.
Das Land Berlin kaufte das Gründerzeitmuseum. Es wurde 1997 vom Förderverein Gutshaus Mahlsdorf e. V. wiedereröffnet und wird seit 2008 aus Mitteln der Lottostiftung Berlin umfassend saniert. Heute beherbergt es die umfangreichste und vollständigste Sammlung von Gegenständen der Gründerzeit. Neben der Dauerausstellung finden im Gutshaus Trauungen und Kulturveranstaltungen jeder Art statt.
Am 30. April 2002 starb Charlotte von Mahlsdorf während eines Berlinbesuches an einem Herzinfarkt. Sie wurde auf dem Evangelischen Waldkirchhof Mahlsdorf an der Rahnsdorfer Straße direkt neben ihrer Mutter Gretchen Berfelde beigesetzt. Die Grabstätte befindet sich in der Abt. W 402/403/404.
Diskussion um die Inschrift auf dem Gedenkstein
Für ihr Wirken als Begründerin einer der bedeutendsten Sammlungen zur Gründerzeit, aber auch für ihr öffentliches Auftreten als Transvestit und bekennende Masochistin wie auch für die Thematisierung der Verfolgung Homosexueller im Dritten Reich wie in der DDR wurde nach einer vom „Förderverein Gutshaus Mahlsdorf“ (dem Förderverein des Gründerzeitmuseums) und der „Interessengemeinschaft Historische Friedhöfe Berlin“ ins Leben gerufenen Spendenaktion ein Gedenkstein für Charlotte von Mahlsdorf im Mahlsdorfer Gutspark aufgestellt. Dieser sollte nach dem Willen der Organisatoren mit einer Tafel mit der Inschrift „Ich bin meine eigene Frau – Charlotte von Mahlsdorf – 18. März 1928 – 30. April 2002“ am ersten Todestag aufgestellt werden. Die Angehörigen Charlotte von Mahlsdorfs wandten sich jedoch gegen die Inschrift und forderten ihre Abänderung. Da die Nachlassfrage nicht geklärt war und der Förderverein des Gründerzeitmuseums Sorge hatte, die Angehörigen könnten die Möbel zurückfordern, wurde dem nachgegeben und die Tafel erhielt den Text „Lothar Berfelde, 1928–2002, genannt Charlotte von Mahlsdorf. Dem Museumsgründer zur Erinnerung“.[9]
Weitere Ehrung
Nach einem Beschluss des Bezirksamtes Marzahn-Hellersdorf wurde am 17. März 2018 eine Straße in einem neuen Eigenheimgebiet Charlotte-von-Mahlsdorf-Ring benannt. Die kleine Straße liegt schräg gegenüber dem Gründerzeitmuseum.[10][11]
Die Bücher von und über Charlotte von Mahlsdorf
- Ich bin meine eigene Frau. Lothar, geboren 1927, Konservator. In: Ganz normal anders. Auskünfte schwuler Männer. Hrsg. v. Jürgen Lemke, Aufbau-Verlag, Berlin 1989, ISBN 3-351-01455-4
- Charlotte von Mahlsdorf: Ich bin meine eigene Frau. Hrsg. v. Peter Süß. Edition diá, Berlin 1992, ISBN 3-86034-109-X; DTV, München 1995, ISBN 978-3-423-20748-5; E-Book: Edition diá 2012, ISBN 978-3-86034-504-7 (Epub), ISBN 978-3-86034-604-4 (Mobi).
- Charlotte von Mahlsdorf, Peter Süß: Ab durch die Mitte. Edition diá, Berlin 1994, ISBN 3-86034-133-2; DTV, München 1997, ISBN 978-3-423-20041-7.
- Gabriele Brang: Berliner Köpfe. Charlotte von Mahlsdorf. Berlin 2004, ISBN 3-89773-125-8.
- Peter Süß: Nichts darf sinnlos enden! Über Charlotte von Mahlsdorf und das Theaterstück „Ich bin meine eigene Frau“. Edition diá, Berlin 2006, ISBN 978-3-86034-159-9.
Verfilmung ihrer Biografie
Der Filmemacher Rosa von Praunheim verfilmte 1992 ihre Biografie in dem Film Ich bin meine eigene Frau.
Filme
- Charlotte in Schweden, Kurzfilm von Rosa von Praunheim 2001
- Charlotte, Kurzfilm von John Edward Heys 2009
- Sonntagskind. Erinnerungen an Charlotte von Mahlsdorf, Dokumentarfilm von Carmen Bärwaldt 2018
Bühnenstücke
Der amerikanische Autor Doug Wright hat basierend auf mit Charlotte von Mahlsdorf geführten Interviews sowie ihrer Autobiografie das Theaterstück I Am My Own Wife verfasst, das 2004 sowohl den Pulitzer-Preis als auch den Tony Award als „Best Play“ gewann. Am 1. Juni 2006 wurde Doug Wright für sein Theaterstück I Am My Own Wife mit dem Kulturpreis Europa ausgezeichnet.
Die Aufführung des amerikanischen Stückes unter dem Titel „I Am My Own Wife“ wurde der amerikanischen Produktion aus Titelschutzgründen in Deutschland vom Rechteinhaber, dem Berliner Verlag Edition diá, der die Rechte an dem deutschen Titel hält, wegen Verwechslungsgefahr mit dem Originaltitel der Autobiografie untersagt.
Am 9. September 2007 hatte am Berliner Renaissance-Theater die deutsche Fassung des amerikanischen Stückes („I Am My Own Wife“) unter dem Titel Ich mach ja doch, was ich will Premiere.
Peter Süß, der Charlotte von Mahlsdorfs Erinnerungen herausgab sowie mit ihr den Berliner Stadtführer Ab durch die Mitte erarbeitete, hat ein eigenes Drama zur Vita Charlotte von Mahlsdorfs verfasst. Es trägt wie die Autobiographie den Titel Ich bin meine eigene Frau und wurde am 26. März 2006 am Schauspiel Leipzig uraufgeführt.
Literatur
- Kurzbiografie zu: Mahlsdorf, Charlotte von. In: Wer war wer in der DDR? 5. Ausgabe. Band 2. Ch. Links, Berlin 2010, ISBN 978-3-86153-561-4.
- Das einfache Lottchen. In: Berliner Zeitung, 6. Juli 1997; zu Fragen ihrer Biografie
Weblinks
- Literatur von und über Charlotte von Mahlsdorf im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Charlotte von Mahlsdorf in der Internet Movie Database (englisch)
- Gründerzeitmuseum Mahlsdorf
- Schauspiel: Ich bin meine eigene Frau
- Schauspiel: I Am My Own Wife (Memento vom 22. Juli 2005 im Internet Archive).
- Tony-Awards 2004
- KulturPreis Europa
Einzelnachweise
- Sebastian Blottner: Eine Berliner Schatztruhe. Berliner Morgenpost, 18. April 2013, abgerufen am 18. März 2019.
- Sonntagskind. Erinnerung an Charlotte von Mahlsdorf. In: Veranstaltungen. Brandenburgische Landeszentrale für politische Bildung, 29. Mai 2018, abgerufen am 18. März 2019.
- Reinhard Wengierek: Charlotte von Mahlsdorfs Lügen im Schlafrock. In: Kultur. WeLT, 10. Dezember 2007, abgerufen am 18. März 2019.
- Abschied in aller Stille – Charlotte von Mahlsdorf tot. n-tv, 10. Mai 2002, abgerufen am 18. März 2019.
- Marcel Gäding: Charlotte von Mahlsdorf wurde am Freitag beigesetzt. Berlins berühmtester Transvestit ist tot. Berliner Zeitung, 11. Mai 2002, abgerufen am 18. März 2019.
- Geschlechterkampf um Charlotte von Mahlsdorf. In: tagesspiegel.de. Abgerufen am 3. Mai 2016.
- Gabriele Brang: Berliner Köpfe. Charlotte von Mahlsdorf. Berlin 2004, S. 175
- Charlotte von Mahlsdorf: Ich bin meine eigene Frau. edition diá, Berlin 1992, S. 85–91.
- Geschlechterkampf um Charlotte von Mahlsdorf. In: www.tagesspiegel.de. Abgerufen am 3. Mai 2016.
- Straße für Charlotte von Mahlsdorf
- Straßenbenennung zu Ehren Charlotte von Mahlsdorfs (Seite nicht mehr abrufbar, Suche in Webarchiven) Info: Der Link wurde automatisch als defekt markiert. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.