Georg Fabricius
Georg Fabricius (eigentlich Goldschmidt; * 23. April 1516 in Chemnitz; † 17. Juli 1571 in Meißen) war protestantischer deutscher Dichter, Historiker, Epigraphiker und Antiquar. Er wurde in Leipzig erzogen und arbeitete bis 1538 als Lehrer in Chemnitz, Freiberg und Meißen.
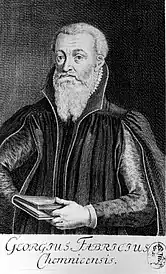
Leben
Fabricius war ein Sohn des Goldschmiedes Georg Goldschmied († 1534) und dessen Frau Margaretha. Er stammte aus einer vermögenden Familie und besuchte zunächst die Thomasschule zu Leipzig, danach die Lateinschule in Chemnitz. 1534 wurde er Schüler des Johannes Rivius in Annaberg. Er freundete sich mit Adam Siber an und war ein Mitschüler von Hiob Magdeburg. Im Wintersemester 1536 immatrikulierte er sich an der Universität Wittenberg, wechselte 1538 an die Universität Leipzig und war dann Lehrer in Chemnitz und Freiberg. 1539 unternahm er mit Wolfgang von Werthern eine Reise durch Italien und machte bis 1543 flächendeckende Studien der römischen Altertümer.
Das Ergebnis veröffentlichte er 1550 als Roma, wobei er den Zusammenhang zwischen jedem erwähnenswerten Relikt der Stadt und ihren Verweisen in der alten Literatur im Detail nachzeichnete. 1544 wurde er Hauslehrer in Straßburg und auf Schloss Beichlingen bei seinen Gönner von Werthern. 1546 wurde er zum Rektor der 1543 gegründeten Fürstenschule St. Afra in Meißen ernannt, ein Amt, das er bis zu seinem Tod innehatte. Mit ungewöhnlichem Eifer setzte er sich trotz vielfacher Schwierigkeiten für die Förderung seiner Schüler ein und wirkte dadurch nicht nur prägend für die Fürstenschule selbst, sondern hatte auch erheblichen Einfluss auf die Entwicklung des sächsischen Schulwesens.
Als Inspektor des Heinrich von Witzleben wurde Fabricius 1549 mit der Einrichtung einer Knabenschule im Kloster zu Roßleben beauftragt (Klosterschule Roßleben). 1549 publizierte er die erste kurze Auswahl römischer Inschriften, wobei er sich besonders auf juristische Texte konzentrierte – ein Meilenstein in der Geschichte der klassischen Epigraphik: zum ersten Mal zeigte ein Humanist ausdrücklich den Wert derartiger archäologischer Relikte für die Rechtsgeschichte im Druck, und gestand dabei stillschweigend den in Stein gemeißelten Inschriften den gleichen Rang wie Manuskripten zu.
1569 erschien sein Annalium urbis Misnae („Annalen der Stadt Meißen“), die die Meißener Stadtgeschichtsschreibung begründet und zu vielen Vorgängen seiner Zeit die einzige Quelle darstellt. Petrus Albinus sollte diese Arbeiten nach seinem Tode weiterführen. In seinen geistlichen Gedichten vermied er jedes Wort, das auch nur den leichtesten Beigeschmack von Heidentum haben könnte und tadelte die Dichter für ihre Anspielungen auf heidnische Gottheiten. 1570 wurde er auf dem Reichstag zu Speyer von Kaiser Maximilian II. zum poeta laureatus gekrönt.
Familie
Aus seiner 1557 geschlossenen Ehe mit Magdalena († 14. April 1572), der Tochter des Schulverwalters Johann Faust, gingen sieben Söhne und drei Töchter hervor.
- Georg besuchte 1578 die Fürstenschule
- Jacob (* 12. Juni 1560) studierte in Straßburg, wo er 1587 den Magistergrad erwarb und als Rektor in Pegau ein Einkommen fand.
- Heinrich hatte 1576 bis 1581 die Meißnerische Fürstenschule besucht, wurde aber aus ihr wieder entlassen.
- Christoph
- Magdalena ⚭ 1584 mit dem Meißner Bürger Leonhard Richter
- Anna ⚭ 1. im November 1588 mit Gabriel Schaaf († 1592) aus Rochlitz, 2. mit Johann Schademann († 1605).
- Maria (* 4. März 1572; † 24. Januar 1609) ⚭ am 14. Mai 1599 mit dem Stadtschreiber in Döbeln Magister David Zeidler (Zeithler).
Fabricius war ein jüngerer Bruder des Dichters Andreas Fabricius, der Pastor in Eisleben war.
Werke
- Ausgaben von Terenz (1548) und Vergil (1551)
- De historia & meditatione mortis Christi, quae in noctis dieiq[ue] tempus distributa est, Hymni XXIIII. Valentin Papa, Leipzig 1552.
- Poëmatum sacrorum libri xxv. 1560.
- Poëtarum veterum ecclesiasticorum opera Christiana. 1562.
- De Re Poëtica libri septem. 1565.
- Chemnicensis In Paenas Tres, Prudentii, Seduli, Fortunati. 1568.
- Rerum Misnicarum libri septem. 1569.
- Annalium urbis Misnae. 1569.
Postum
- Originum illustrissimae stirpis Saxonicae libri septem. 1597.
- Rerum Germaniae magnae et Saxoniae universae memorabilium mirabiliumque volumina duo. 1609.
Literatur
- Fabricius’ Biographie wurde 1839 von D. C. W. Baumgarten-Crusius veröffentlicht, der 1845 auch eine Ausgabe seiner Epistolae ad W Meurerum et alios aequales mit einer kurzen Skizze De Vita Ge. Fabricius de gente Fabriciorum herausgab.
- Johann August Müller: Versuch einer vollständigen Geschichte der Chursächsischen Fürsten- und Landesschule zu Meissen, aus Urkunden und glaubwürdigen Nachrichten. Siegfried Lebrecht Crusius, Leipzig 1789, S. 3 (books.google.de).
- Fabricius, Georgius. In: Johann Heinrich Zedler: Grosses vollständiges Universal-Lexicon Aller Wissenschafften und Künste. Band 9, Leipzig 1735, Sp. 38 f.
- Fabricius (Georg.), ein berühmter Poet und Criticus. In: Christian Gottlieb Jöcher (Hrsg.): Compendiöses Gelehrten-Lexicon … 3. Auflage. Band 1: A–L. Johann Friedrich Gleditsch, Leipzig 1733, Sp. 1041–1042 (Textarchiv – Internet Archive).
- Fabricius (Georg.), ein Poet und Criticus. In: Christian Gottlieb Jöcher (Hrsg.): Allgemeines Gelehrten-Lexicon. Band 2: D–L. Johann Friedrich Gleditsch, Leipzig 1750, Sp. 481–482 (books.google.de).
- Johann Samuel Ersch, Johann Gottfried Gruber: Allgemeine Encyclopädie der Wissenschaften und Künste. Band 40, 1844, S. 58 (gdz.sub.uni-goettingen.de).
- Heinrich Julius Kämmel: Fabricius, Georg. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 6, Duncker & Humblot, Leipzig 1877, S. 510–514.
- Herbert Schönebaum: Fabricius, Georg. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 4, Duncker & Humblot, Berlin 1959, ISBN 3-428-00185-0, S. 734 f. (Digitalisat).
- Kurt Hannemann: Der Humanist Georg Fabricius in Meissen, das Luthermonotessaron in Wittenberg und Leipzig und der Heliandpraefatiokodex aus Naumburg a. d. Saale. In: Annali. Istituto Orientale di Napoli. Filologia Germanica. 17, 1974, S. 7–109.
- Eckart Schäfer: Deutscher Horaz. Conrad Celtis, Georg Fabricius, Paul Melissus, Jacob Balde. Die Nachwirkung des Horaz in der neulateinischen Dichtung Deutschlands, Wiesbaden 1976, ISBN 3-515-02150-7.
- Hermann Wiegand: Walther Killys Literaturlexikon: Autoren und Werke deutscher Sprache. Band 2, Bertelsmann-Lexikon-Verlag, Gütersloh/ München 1989, ISBN 3-570-03702-9, S. 320 (CD-ROM, Berlin 1998, ISBN 3-932544-13-7).
- Wilhelm Kühlmann, Robert Seidel, Hermann Wiegand: Humanistische Lyrik des 16. Jahrhunderts. Lateinisch und deutsch. Deutscher Klassiker Verlag, Frankfurt am Main 1997, ISBN 3-618-66350-1, S. 1311.
- Heinz Scheible: Melanchthons Briefwechsel. Band 12: Personen. Stuttgart-Bad Cannstatt 2005, ISBN 3-7728-2258-4.
Weblinks
- Literatur von und über Georg Fabricius im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Werke von und über Georg Fabricius in der Deutschen Digitalen Bibliothek