Esperanto-Kultur
Die Esperanto-Kultur ist die Kultur der Esperanto-Sprachgemeinschaft, die sich vor allem in der Literatur, gemeinsamen Symbolen und Kongressen niederschlägt und teils aus genuinen (z. B. Originalliteratur, eigenständig geprägte Phraseologismen), teils aus übernommenen Elementen (z. B. Übersetzungsliteratur, Lehnübersetzungen) besteht.

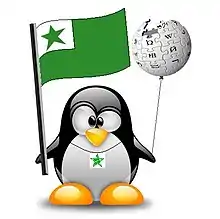
Identität
Beim ersten Esperanto-Weltkongress, in Boulogne-sur-Mer 1905, wurde eine „Deklaration über das Wesen des Esperantismus“ beschlossen; die Anhänger des Esperantismus, des „Bestrebens, in der ganzen Welt die Verwendung einer neutralen Sprache zu verbreiten“, definierten damals als „Esperantisten“ jeden, der die Sprache kennt und verwendet, egal zu welchem Zweck.[1] Ergänzend wurde erläutert, dass die Verfolgung oder Nichtverfolgung von Idealen in Zusammenhang mit der Verbreitung der Sprache die private Angelegenheit jedes einzelnen Sprechers sei.
Symbole
Das bedeutendste Symbol des Esperanto ist ein grünes Pentagramm auf weißem Grund, das sich auch in der Esperantoflagge wiederfindet. Das Gedicht La Espero gilt als Hymne des Esperanto. In ihr ist die Rede von Weltfrieden, Eintracht und den andauernden Segnungen einer neutralen Sprache.[2]

Das nebenstehende Bild stammt vom VI. Deutschen Esperanto-Kongress aus dem Jahr 1911. Dies ist der bis dahin erfolgreichste und sollte es auf Jahre hinaus bleiben. Auf dem nebenstehenden Bild sind Kongressteilnehmer dreier Gliedstaaten in ihren landestypischen Trachten die junges ein Mädchen in einen weißen Kleid mit einem Esperanto-Stern, dass zu zusätzlich eine Esperantofahne trägt, abgebildet. Die Personen standen symbolisch für die verschiedenartigen Sprachen in deren Zentrum sich das junge Esperanto befand.
Das Motto des Kongresses, „Wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen“, bezog sich auf die praktische Lösung des Weltsprachenproblems. Die exemplarische Botschaft des Bildes war die gleichzeitige Kommunikationsmöglichkeit aller unter der Nutzung der sie verbindenden Kunstsprache als Weltsprache.
Literatur
Im Unterschied zu natürlichen Sprachen nimmt die Schriftkultur einen deutlich höheren Stellenwert ein, denn anders als Plansprachen wie Ido, Occidental und Interlingua war Esperanto von Anfang an als Literatursprache angelegt.[3] Die Esperanto-Literatur hat ihre eigenen Autoren, welche auf Esperanto schreiben oder geschrieben haben.[4] Bei Übersetzungen ins Esperanto dominieren nicht die großen Sprachen.[5] Übersetzungen spielten in der Anfangsphase des Esperanto eine wichtige Rolle. Sie dienten dazu, die Möglichkeiten der Sprache auszutesten und zu erweitern.[6] Esperanto hat eine eigene Phraseologie mit esperanto-spezifischen Begriffen, Sprichwörtern, Redensarten und Wortspielen.[5]
Gedenk- und Aktionstage
Am 15. Dezember, dem Geburtstag des Erfinders der Welthilfssprache, feiern Esperantosprecher den Zamenhoftag. Ein alternativer Name lautet „Tag des Esperanto-Buchs“.[7] Ein weiterer Esperantotag ist der 26. Juli. Er erinnert an die Veröffentlichung des ersten Esperanto-Lehrbuchs im Jahr 1887.
Theater

Kleinere Theaterstücke gab es auf dem Ersten Esperanto-Weltkongress 1905. Im Rahmen des Esperanto-Weltkongresses 1908 in Dresden wurde Goethes Iphigenie auf Tauris auf Esperanto aufgeführt. In den 1980er und 1990er Jahren spielte die internationale Gruppe Kia Koincido. Heute gibt es zum Beispiel eine Theatergruppe in Toulouse (Frankreich).[8]
Filme

Auch einige Filme wurden auf Esperanto gedreht. Der erste Spielfilm auf Esperanto ist Angoroj.[9] Der bekannteste Film ist der 1966 gedrehte Inkubo mit William Shatner in der Hauptrolle.[10]
Kulturelle Veranstaltungen
Vereinzelte Festivals haben Esperanto-Kultur zum Thema. Solche Veranstaltungen fanden 2005 in Skandinavien[11], Russland[12], Polen[13], der Ukraine[14] und Frankreich[15] statt.
Museen und Bibliotheken
In Wien befindet sich das Internationale Esperanto-Museum. Die zugehörige Sammlung für Plansprachen ist Teil der Österreichischen Nationalbibliothek.[16] Die Deutsche Esperanto-Bibliothek ist in Aalen beheimatet.[17] Die Bibliothek Hector Hodler befindet sich in Rotterdam (Niederlande).[18]
Stiftungen und Preise
Die Stadt Aalen vergibt zusammen mit der FAME-Stiftung zur Förderung internationaler Verständigungsmittel den FAME-Esperanto-Kulturpreis.[17] Die Stiftung Mondo hat einen eigenen Fond für Esperanto-Kultur.[19]
Der Esperanto-Weltbund veranstaltet seit 1950 jedes Jahr die Belartaj Konkursoj (Wettbewerbe der schönen Künste). In den Kategorien Poesie und Prosa werden seit 1976 nur Beiträge zugelassen, die auf Esperanto verfasst wurden. Seit jenem Jahr gibt es eine Kategorie für Essays. Diese dürfen ebenfalls nur Esperanto-Originale sein. 1984 kam die Kategorie Lied hinzu.[20][21][22] In den Vereinigten Staaten fördert die Esperantic Studies Foundation (ESF) auf vielen Bereichen die Esperanto-Kultur.
Währung

Um die Kommunikation unter Esperantisten auch auf finanzieller Ebene zu erleichtern, entwarf René de Saussure 1907 die Währungseinheit Speso. Ein wichtiger Förderer dieser Idee war der deutsche Bankier und Esperantist Herbert Hoveler. Zu diesem Zweck gründete er die Ĉekbanko Esperantista, welche Schecks auf Speso herausgab. Daraufhin wurde er in kleinem Umfang auch durch britische und schweizerische Banken genutzt. Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs 1914 beendete die Verwendung des Spesos. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs im Jahr 1945 wurde mit dem Stelo ein erneuter Versuch eine einheitliche Weltwährung unter Esperantisten zu etablieren gestartet. Auch dieser Versuch scheiterte.
Sonstiges
Der 1936 entdeckte Asteroid (1421) Esperanto wurde nach der Sprache und der zwei Jahre später entdeckte Asteroid (1462) Zamenhof nach ihrem Erfinder benannt.
Herzberg am Harz bezeichnet sich als Die Esperanto-Stadt.
Siehe auch
Weblinks
Einzelnachweise
- Bulonja Deklaracio; Deklaracio pri la esenco de la Esperantismo (wikisource)
- Himno Esperantista (Memento vom 9. Februar 2006 im Internet Archive) Enciklopedio de Esperanto, Buchstaben H und Ĥ, Stichwort Himno Esperantista.
- Blanke, Detlev: Interlinguistische Beiträge. Zum Wesen und zur Funktion internationaler Plansprachen. Herausgegeben von Sabine Fiedler. Frankfurt/Main u. a.: Peter Lang Europäischer Verlag der Wissenschaften, 2006, ISBN 3-631-55024-3, S. 224f.
- Ronald J. Glossop: La kulturo de Esperanto.
- Fiedler, Sabine: Plansprache und Phraseologie: Empirische Untersuchungen zu reproduziertem Sprachmaterial im Esperanto. Verlag Peter Lang, Frankfurt, 1999. ISBN 3-631-34088-5
- Fabian-Handbuch: Deutsche Esperanto-Bibliothek.
- „tago de la esperanta libro“ „La mondo festis Zamenhof-tagon“, Libera Folio.
- Teatro Trupo Tuluzo
- Angoroj in der Internet Movie Database (englisch)
- imdb.com
- Kultura Esperanto-Festivalo (KEF)
- Esperanto – Lingvo Arta (EoLA)
- Artaj Konfrontoj en Esperanto (Arkones) (Memento des Originals vom 23. Oktober 2007 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
- Velura Sezono
- Kultura kaj Arta Festivalo de Esperanto (KAFE)
- Sammlung für Plansprachen der ONB (Memento des Originals vom 18. Dezember 2007 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
- Internetauftritt der Stadt Aalen (Memento des Originals vom 19. Oktober 2007 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
- Biblioteko Hector Hodler (Memento des Originals vom 6. Oktober 2007 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
- Internetauftritt der Stiftung Mondo
- Belartaj Konkursoj 1950-1999, Sten Johansson, 2000.
- detaillierte Teilnahmeregeln (Memento des Originals vom 31. Oktober 2007 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
- Übersicht mit den Gewinnern von 1950 bis 2007