Robert Weltsch
Robert Weltsch (* 20. Juni 1891 in Prag, Österreich-Ungarn; † 22. Dezember 1982 in Jerusalem, Israel) war ein israelischer Publizist, Journalist und Zionist.
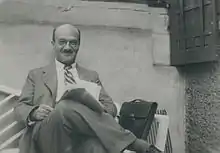
Leben
Der Sohn des Advokaten Theodor Weltsch (gest. 1922) war, wie viele später bekannte jüdische Prager Studenten, Mitglied in der Vereinigung Bar Kochba. Er studierte an der juristischen Fakultät der Prager Deutschen Universität.
Von 1919 bis 1938 war er Chefredakteur und Mitherausgeber der Zeitschrift Jüdische Rundschau in Berlin und wurde durch einige Artikel mit offener Kritik gegen Hitler weiter bekannt. Berühmtheit erlangte sein in der Rundschau am 4. April 1933[1] erschienener Leitartikel zum Boykott-Tag am 1. April 1933: Tragt ihn mit Stolz, den gelben Fleck!.[2][3]
1938 emigrierte Robert Weltsch nach Palästina und überlebte so den Holocaust. In Jerusalem war er in den Jahren 1939 und 1940 Chefredakteur der Jüdischen Welt-Rundschau.
Nach dem Zweiten Weltkrieg siedelte Weltsch nach England über und arbeitete für verschiedene zionistische Institute als Publizist, unter anderem in London leitend für das Leo Baeck Institut. Ebenfalls war er Korrespondent der israelischen Tageszeitung Haaretz. Seine letzten Lebensjahre verbrachte er ab 1978 in Israel.
Sein Cousin Felix Weltsch gab die tschechoslowakische zionistische Zeitschrift Selbstwehr heraus. Beide stammen aus einer alten Prager Familie.
Schriften (Auswahl)
- Zionistische Politik. Mährisch-Ostrau 1927 (gemeinsam mit Hans Kohn).
- Ja-Sagen zum Judentum. 1933.
- Deutsches Judentum. Aufstieg und Krise. (14 Monographien), 1963.
Literatur
- John F. Oppenheimer (Red.) u. a.: Lexikon des Judentums. 2. Auflage. Bertelsmann Lexikon Verlag, Gütersloh u. a. 1971, ISBN 3-570-05964-2, Sp. 861.
- Christian Wiese: Das "dämonische Antlitz des Nationalismus": Robert Weltschs zwiespältige Deutung des Zionismus angesichts von Nationalsozialismus und Shoah. In: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, Jg. 60, 2012, Heft 7/8, S. 618–645.
Weblinks
Einzelnachweise
- Deutsches Reich 1933-1937: Band 1 von Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland, S. 115. Abgerufen am 13. Januar 2012.
- Das verpflichtende Tragen des „Judensterns“ wurde allerdings erst 1939 (besetztes Polen) bzw. 1941 (Deutsches Reich) eingeführt.
- http://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/cm/periodical/pageview/2686535