Ludwig Viktor von Österreich
Erzherzog Ludwig Viktor Joseph Anton von Österreich (* 15. Mai 1842 in Wien; † 18. Jänner 1919 in Kleßheim) war der jüngste Sohn von Erzherzog Franz Karl von Österreich und dessen Ehefrau Sophie Friederike von Bayern und jüngster Bruder des Kaisers Franz Joseph I. von Österreich.

Leben

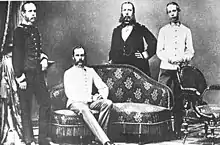


Nach dem frühen Tod von Maria Anna Karolina (welche bereits mit vier Jahren verstarb) sollte das nächste Kind der Familie ein Mädchen werden, nachdem bereits drei Söhne vorhanden waren. Mit Ludwig Victor, genannt „Luzi-Wuzi“, wurde wieder ein Bub geboren. Der Knabe spielte sich schon früh bei jeder Gelegenheit in den Mittelpunkt, wobei seine ironischen bis zynischen Bemerkungen auf Kosten anderer oft als geistreich belächelt und ihm als Nesthäkchen lange eine gewisse Narrenfreiheit eingeräumt wurde.[1]
Während der Revolution von 1848 floh er im März 1848 mit der kaiserlichen Familie nach Innsbruck und nach Ausbruch des Wiener Oktoberaufstandes 1848 nach Olmütz. Der Sechsjährige soll beim Anblick von zum Tode verurteilten Revolutionären um deren Freilassung gebeten haben. Später durchlief er die für Mitglieder des Kaiserhauses traditionelle Militärlaufbahn und erreichte 1908 den Rang eines Generals der Infanterie.[2] Ab 1860 war er zudem Regimentsinhaber des Infanterieregiments Nr. 65 „Erzherzog Ludwig Viktor“.[3]
Den Plan seines Bruders Maximilian, des Kaisers von Mexiko, dort sein Nachfolger zu werden, lehnte er ab. Maximilian hätte sogar eine passende politische Heirat für ihn im Auge – Isabel, die Erbtochter von Kaiser Pedro II., der Brasilien aufgrund seiner umsichtigen Regierung zu unerwarteter Blüte geführt hatte. Diese Heirat würde die Länder Mexiko und Brasilien miteinander vereinigen.[1] Stattdessen beschäftigte sich Ludwig Viktor vorwiegend mit Kunstsammlungen und baute Palais. Bekannt sind vor allem das von Heinrich von Ferstel im Renaissancestil erbaute Palais Erzherzog Ludwig Viktor am Schwarzenbergplatz und die von ihm ausgesuchte Ausstattung des Schlosses Kleßheim. In seinem Palais veranstaltete er Feste, wobei er die Anwesenheit von Männern der von Frauen vorzog. Seine homosexuelle Orientierung war ein offenes Geheimnis, wobei Ludwig jedoch auch ein langes Verhältnis mit der Tänzerin Claudia Couqui hatte. Dies tat jedoch seinen Beziehungen zu seinem kaiserlichen Bruder und seiner Familie keinen Abbruch, wie seine Privatkorrespondenz beweist.
Nach seinem Umzug nach Salzburg Ende 1861 widmete er sich weiter neuen Bauten (beispielsweise der Errichtung des Kavalierhauses Kleßheim auf Schloss Kleßheim im Jahr 1879), wohltätigen Spenden und der Kunstförderung (er war Mäzen des Salzburger Kunstvereins). 1896 ernannte ihn der Kaiser zur Aufsichtsperson über das Österreichische Rote Kreuz, das nach der Schlacht von Solferino (1859) entstanden war.
Ludwig Viktors 60. Geburtstag 1902 wurde in Wien in großem Rahmen gefeiert; darüber gibt es zahllose offizielle Presseberichte.[4]
Am 24. August 1902 eröffnete er die dann nach ihm benannte „Erzherzog-Ludwig-Viktor-Brücke“ über die Salzach. Im Weiteren wurde von den Salzburgern, die den Erzherzog teils liebevoll, teils herablassend Luziwuzi nannten, auch der Alte Markt in „Ludwig-Viktor-Platz“ umbenannt.
In seinen letzten Jahren zeigten sich Anzeichen geistiger Verwirrung. Der inzwischen unter Kuratel Gestellte starb 1919 mit 76 Jahren kinderlos als letzter der Söhne Erzherzog Franz Karls auf Schloss Kleßheim und liegt auf dem Friedhof von Siezenheim, an der Ostseite der Pfarrkirche Siezenheim, begraben.[1]
Die Zeitgenossin Fürstin Nora Fugger beschrieb den Erzherzog in ihren Mémoiren:
„Er war grundverschieden von seinen Brüdern, war weder militärisch noch kunstverständig, schwächlich, unmännlich, geziert und von garstigem Äußerem. Man fürchtete ihn wegen seiner Medisance [franz. boshaften Seitenhiebe]. Er führte ein sehr weltliches Leben, war über alles – nicht immer richtig – unterrichtet, seine Zunge war scharf wie die einer Giftschlange. In alles mischte er sich ein, spann daraus Intrigen und freute sich, wenn kleine Skandälchen daraus wurden. Man hatte allen Grund, seine Indiskretionen und Tratschereien zu fürchten; doch er war der Bruder des Kaisers. Eine gute Seite hatte er aber doch: Er war der Freund seiner Freunde – mehr als seiner Freundinnen –, er verteidigte sie, wenn sie von der Welt angegriffen wurden, und bewies ihnen allerlei Amabilitäten. Alten – mehr als jungen – Damen war er von größter Aufmerksamkeit und Liebenswürdigkeit. Er merkte sich alle Geburts- und Namenstage und schickte ihnen Blumen. Von diesen alten Damen wurde er natürlich sehr verehrt. Wenig beliebt war er in der kaiserlichen Familie, denn auch da wußte er immer etwas zu bekritteln oder etwas zu vertratschen.[5]“
Vorfahren
Trivia
.tif.jpg.webp)
Ludwig Viktor wurden zeitlebens zahlreiche Eskapaden nachgesagt: So soll er zuweilen Frauenkleider getragen haben und sich darin sogar fotografieren haben lassen. Außerdem sei seine Versetzung nach Salzburg durch den Kaiser wegen einer Prügelei unter Homosexuellen erfolgt. Tatsächlich war Ludwig Viktor in diese Affäre im Centralbad (heute Kaiserbründl) verwickelt, in der österreichischen Presse wurde dies jedoch nicht thematisiert. Anspielungen auf diesen „Skandal“ scheint nur die ausländische „Judenpresse“ unternommen zu haben, wie das Wiener Satireblatt Kikeriki Mitte 1904 schrieb.[6] Als Quelle wird bis heute lediglich der „Hoftratsch“ herangezogen, den die Gräfin Nora Fugger wie folgt kolportierte:
„In seinem Palais in Wien fehlte das Schwimmbad. Und so machte er es sich zur Gewohnheit, zweimal wöchentlich in Gesellschaft seines Adjutanten in einer öffentlichen Badeanstalt zu erscheinen. Wie oft sah ich seinen Hofwagen in der Weihburggasse stehen. Die Frage lag nahe, wie es sich mit der strengen Etikette am österreichischen Hofe vereinbaren lasse, daß ein Erzherzog in einem öffentlichen Schwimmbassin mit n’importe qui [franz. jedem x-Beliebigen] baden durfte. Mir erschien die Sache eigentümlich, nicht unbedenklich. Und ich hatte nicht so unrecht, denn eines schönen Tages kam es tatsächlich zu einem großen Skandal, ja sogar zu einem Handgemenge in der Badeanstalt. Man erzählte sich, der Erzherzog habe eine Ohrfeige erwischt und die Flucht ergreifen müssen. Dem Kaiser wurde diese Skandalaffäre – natürlich in den grellsten Farben – geschildert. Er war aufs höchste empört und befahl dem Bruder, Wien sofort zu verlassen und sich auf sein Schloß Kleßheim zurückzuziehen. Dort verblieb der Erzherzog bis an sein Lebensende interniert.[5]“
Literatur
- Constantin von Wurzbach: Habsburg, Ludwig Joseph Anton Victor. In: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich. 6. Theil. Kaiserlich-königliche Hof- und Staatsdruckerei, Wien 1860, S. 449 (Digitalisat).
- Gassner: Ludwig (Joseph Anton) Viktor Erzherzog von Österreich. In: Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950 (ÖBL). Band 5, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 1972, S. 351.
- Brigitte Hamann: Die Habsburger. Ein biographisches Lexikon. Wien 1988.
- Katrin Unterreiner: Luziwuzi: das provokante Leben des Kaiserbruders Ludwig Viktor, Molden-Verlag, Wien 2019, ISBN 978-3-222-15033-3
Weblinks
- Werke von und über Ludwig Viktor von Österreich in der Deutschen Digitalen Bibliothek
- Eintrag zu Ludwig Viktor von Österreich in Kalliope
- Lieselotte von Eltz-Hoffmann: Ludwig Viktor (1842–1919): Ein Gönner Salzburgs (Memento vom 30. April 2006 im Internet Archive)
- Ein unglücklicher kaiserlicher Prinz. Erzherzog Ludwig Viktor von Oesterreich. Neues Wiener Journal, 23. September 1923, S. 5.
- Hans Pischek: Erzherzog Ludwig Viktor. Salzburger Volksblatt, 3. August 1926, S. 4.
- Auch ein Habsburger. Der Erzherzog Ludwig Viktor. Arbeiter Zeitung, 5. August 1926, S. 9.
Einzelnachweise
- Sigrid-Maria Größing: Um Krone und Liebe. Amalthea Verlag, Wien 2008, ISBN 978-3-85002-649-9, S. ?
- Tibor Balla: A Nagy Háború osztrák–magyar tábornoka: Tábornagyok, vezérezredesek, gyalogsági és lovassági tábornokok, táborszernagyok. Argumentum, Budapest 2010, ISBN 978-963-446-585-0, S. 217–218. (PDF)
- Alphons von Wrede, Anton Semek: Die Geschichte der k. u. k. Wehrmacht: Die Regimenter, Corps, Branchen und Anstalten von 1618 bis Ende des XIX. Jahrhunderts. Band I: Infanterie. L.W. Seidel & Sohn, Wien 1898, S. 575f. (Digitalisat)
- Sport und Salon, 24. Mai 1902.
- Nora Fugger: Im Glanz der Kaiserzeit. Amalthea Verlag, Wien 1932, S. 126–128.
- Kikeriki, 9. Juni 1904.