Kreisordnung (Preußen)
Die Preußische Kreisordnung von 1872 regelte die Organisation der preußischen Kreise neu.
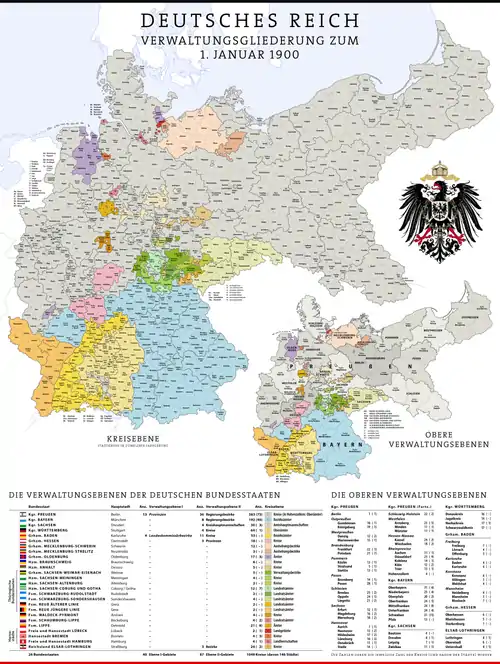
Geschichte
Nach langjährigen und teilweise schwierigen Verhandlungen trat die Kreisordnung als Gesetz am 13. Dezember 1872 in Kraft und bildete in der Folgezeit auch die Basis für eine neue Provinzialordnung.
Das Gesetz erstreckte sich zunächst nur auf die Provinzen Preußen, Brandenburg (mit Berlin), Pommern, Schlesien und Sachsen mit der Maßgabe, dass es durch königliche Verordnung in der Provinz Posen oder Teilen davon in Kraft gesetzt werden konnte.
Inhalt
Rechtliche Stellung
Jeder Kreis bildete einen Kommunalverband zur Selbstverwaltung seiner Angelegenheiten mit den Rechten einer Korporation. Städte mit mindestens 25.000 Einwohnern durften einen Stadtkreis für sich bilden. Glieder des Kreises waren die Städte, soweit sie nicht eigene Stadtkreise bildeten, und die Amtsbezirke. Diese wiederum umfassten mehrere Landgemeinden. Für den Bereich eines selbständigen Gutsbezirks war dessen Besitzer oder ein von ihm bestellter Vertreter Ortsobrigkeit. Ihm oblagen die Pflichten und Leistungen, die auch den Landgemeinden oblagen.
Selbstverwaltung
Jeder Kreis war im Rahmen seiner Selbstverwaltung befugt, Anordnungen und Reglements zu erlassen. Die kreisangehörigen Gemeinden mussten eine Kreisumlage durch Zuschläge zu den direkten Staatsteuern, insbesondere zur Klassen- und Einkommensteuer, erbringen. Kreisangehörige waren verpflichtet, Ehrenämter anzunehmen.
Landrat
An der Spitze der Verwaltung stand der auf Vorschlag des Kreistags vom König ernannte Landrat. Er hatte eine Doppelfunktion als Chef der Selbstverwaltung und als Organ der Staatsregierung. Zugleich war er Vorsitzender des Kreistags und Kreisausschusses. Ihm war ein Kreissekretär zugeteilt, und zwei gewählte Kreisdeputierte. Letztere vertraten ihn. Bei kurzzeitiger Verhinderung konnte das auch der Kreissekretär.
Kreisausschuss
Ein vom Kreistag gewählter Kreisausschuss von sechs Mitgliedern stand dem Landrat in der Verwaltung der Kreisangelegenheiten und Wahrnehmung der Geschäfte der allgemeinen Landesverwaltung zur Seite.
Kreistag
Der Kreistag bestand aus mindestens 25 Mitgliedern. Er musste mindestens zweimal im Jahr zusammentreten. Gewählt wurde er nach einem Proporzsystem, bei dem die Einwohner der Stadtgemeinden – nach ihrem Bevölkerungsanteil am Kreis – bis zur Hälfte der Mitglieder wählten, während die übrigen Mitglieder gleichmäßig zum einen von den Einwohnern der Landgemeinden, zum anderen von den ländlichen Grundbesitzern gewählt wurden, die mindestens 150 bis 450 Mark staatlicher Grund- und Gebäudesteuer abführten. Es handelte sich um indirekte Wahlen durch Wahlmänner. Die Legislaturperiode betrug sechs Jahre.
Wissenswert
Im Großherzogtum Hessen wurde 1874 eine Kreisordnung in Kraft gesetzt, die sich nach dem Modell der Preußischen Kreisordnung von 1872 richtete.[1]
Quellen
- Kreisordnung für die Provinzen Preußen, Brandenburg, Pommern, Posen, Schlesien und Sachsen vom 13. Dezember 1872. In: Gesetz-Sammlung für die Königlich Preußischen Staaten Nr. 41 vom 23. Dezember 1872, S. 661–714.
Einzelnachweise
- Gesetz, betreffend die innere Verwaltung und Vertretung der Kreise und der Provinzen vom 12. Juni 1874. In: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt Nr. 29 vom 16. Juni 1874, S. 251–295; Eckhart G. Franz: Einleitung. In: Georg Ruppel und Karin Müller: Historisches Ortsverzeichnis für das Gebiet des ehem. Großherzogtums und Volksstaats Hessen mit Nachweis der Kreis- und Gerichtszugehörigkeit von 1820 bis zu den Veränderungen im Zuge der kommunalen Gebietsreform = Darmstädter Archivschriften 2. Historischer Verein für Hessen. Darmstadt 1976.