IWB
IWB (Industrielle Werke Basel) ist das Unternehmen für Energie, Wasser und Telekommunikation im Kanton Basel-Stadt (Schweiz). Als öffentlich-rechtliche Anstalt ist das Unternehmen seit dem Jahr 2010 selbständig und arbeitet eng mit dem Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt des Kantons Basel-Stadt zusammen.
| IWB (Industrielle Werke Basel) | |
|---|---|
 Logo | |
| Rechtsform | Öffentlich-rechtliche Anstalt |
| Gründung | 1852 |
| Sitz | Basel, Schweiz |
| Leitung | Claus Schmidt (CEO) Urs Steiner, (Verwaltungsratspräsident) |
| Mitarbeiterzahl | 862 (2018)[1] |
| Umsatz | 767 Mio. CHF (2018)[1] |
| Branche | Versorgung, Energiedienstleistung |
| Website | www.iwb.ch |
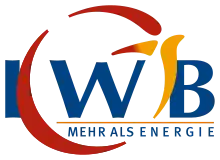
Tätigkeitsgebiet
Die Aktivitäten von IWB umfassen im Wesentlichen die Bereiche Stromversorgung, Wasserversorgung, Erdgasversorgung, Fernwärmeversorgung und die Kehrichtverwertung sowie Energie- und Telekommunikationsdienstleistungen.
Als Stromversorger beliefert IWB den Kanton Basel-Stadt mit rund 1’600 GWh Strom pro Jahr. Dieser wird vor allem in acht Wasserkraftwerken und Windkraftwerken in Frankreich und Deutschland, an denen IWB beteiligt ist, produziert. Ein kleinerer Teil wird in lokalen Wärme-Kraft-Koppelungsanlagen produziert. Zum Ausgleich von Produktionsschwankungen betreibt IWB auch Stromhandel. Der Strommix der IWB setzt sich aus 92,58 % Wasserkraft, 1,12 % Sonnenenergie und 6,3 % gefördertem Strom zusammen (Stand 2019).[2]
Über ein 568 Kilometer langes Leitungsnetz versorgt IWB ihre Kunden im Kanton Basel-Stadt sowie in angrenzenden Gebieten mit rund 28 Millionen m³ Trinkwasser. Dieses stammt vollständig aus in zwei Werken gewonnenem Grundwasser. Von 1996 bis 2012 boten die IWB auch mit Kohlensäure angereichertes Tafelwasser unter der Bezeichnung «Basler Wasser» in Flaschen, deren Etiketten einen von Ferdinand Schlöth entworfenen Basilisken von der Wettsteinbrücke zeigten, zum Verkauf an.[3]
Im Bereich der Erdgasversorgung ist IWB weit über den Kanton hinaus regional tätig und versorgen über ihr 1'040 Kilometer langes Netz 406'000 Menschen im Kanton Basel-Stadt sowie in Teilen des Kantons Basel-Landschaft und des Fricktals mit rund 4’000 GWh Erdgas. Dieses wird vollständig von der Gasverbund Mittelland AG bezogen. Die 1852 aufgenommene Erdgasversorgung bildet den ältesten Geschäftsbereich von IWB.
IWB liefert rund 1'000 GWh Fernwärme. Diese wird zur Hälfte in der Kehrichtverwertungsanlage produziert. Gut 40 % werden aus Erdgas im Fernheizkraftwerk Voltastrasse und dem Spitzenheizwerk Bahnhof produziert, rund 10 % im Holzkraftwerk Basel aus Holzhackschnitzeln.
Über ihre traditionelle Versorgungsaktivitäten hinaus bietet IWB auch Dienstleistungen in der Wärmetechnik und betreibt ein 299 Kilometer langes Glasfasernetz für Breitband-Internet und Telefonie.
Geschichte
IWB hat ihren Ursprung in der 1852 gegründeten privaten Gasindustrie. Diese wurde 1867 verstaatlicht. 1875 wurde die Wasserversorgung in das Gaswerk eingegliedert und 1882 mit dem Pumpwerk Lange Erlen das erste der beiden heute aktiven Grundwasserwerke in Betrieb genommen. 1899 kam das neu gegründete Elektrizitätswerk Basel hinzu, das 1908 jedoch wieder vom Gas- und Wasserwerk getrennt wurde. 1942 begannen die Werke, Fernwärme zu nutzen.
1978 wurde das Elektrizitätswerk wieder mit den Bereichen Gas- und Wasserversorgung zusammengelegt und daraus IWB gebildet. In diese wurde 1998 die Kehrichtverwertungsanlage integriert. Seit dem 1. Januar 2010 ist IWB ein selbständiges Unternehmen im Besitz des Kantons Basel-Stadt.
Literatur
- Karl Albert Huber: Die Basler Wasserversorgung von den Anfängen bis heute, in: Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde 54 (1955), S. 63–122 (Volltext)
- Industrielle Werke Basel (Hrsg.), David Tréfás, Christoph Manasse: Vernetzt, Versorgt, Verbunden. Die Geschichte der Basler Energie- und Wasserversorgung. Christoph Merian Verlag, Basel 2006, ISBN 3-85616-286-0
- René B. Gally: 75 Jahre Elektrizitätswerk Basel. Perspektiven der Elektrizitäts- und Energieversorgung. In: Basler Stadtbuch 1974, S. 41-50.
Einzelnachweise
- IWB Industrielle Werke Basel - Geschäftsbericht 2017. (Nicht mehr online verfügbar.) Ehemals im Original; abgerufen am 23. Juni 2018. (Seite nicht mehr abrufbar, Suche in Webarchiven) Info: Der Link wurde automatisch als defekt markiert. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
- www.stromkennzeichnung.ch, abgerufen am 20. November 2020
- Basler Zeitung, 27. März 2012; Stefan Hess: Zwischen Winckelmann und Winkelried. Der Basler Bildhauer Ferdinand Schlöth (1818–1891). Berlin 2010, S. 89.