Georg Franz Hofmann
Georg Franz Hofmann (* 23. April 1765[1] in Burrweiler, Rheinpfalz; † 13. März 1849[2] in Wien) war ein schweizerisch-deutscher Pädagoge und Autor. Er bekleidete eine der wichtigsten Kanzleistellen in der Helvetischen Republik, präsidierte die Schulkommission der neu eröffneten Kantonsschule in Aarau, war am Erziehungsinstitut Johann Heinrich Pestalozzis in Yverdon tätig und gründete eigene Schulen in Neapel und Budapest.
Leben

in Mannheim.
Hofmanns Biografie ist noch kaum erforscht. Er selber hatte grösste Mühe, einen Taufschein beizubringen.[3] Sicher ist, dass er Katholik war. Sein Vater soll Peter geheissen haben.[4] Er dürfte mit dem „Georgius Franciscus Hoffmann, Burweileranus“ identisch sein, der an der Universität Heidelberg 1782 „t(itulo) p(aupertatis)“ (als Armer) immatrikuliert wurde und 1784 um „Büchsen- und Purgatorgeld“ (Stipendien?) ersuchte[5]. Zur Zeit seiner Immatrikulation machte in Heidelberg der reformierte Kirchenrat Johann Friedrich Mieg Werbung für den Illuminatenorden.[6] Von einer Mitgliedschaft Hofmanns, der damals noch sehr jung war, ist aber nichts bekannt.
Auf dem Titelblatt einer seiner späteren Veröffentlichungen[7] wird er Dr., auf jenem einer andern[8] wohl zutreffender Philos(ophiæ) Mag(ister) genannt.[9] Hofmann selber schreibt: „Die Revolution zog mich von dem Lehramte, das ich in meinem Vaterlande, der rheinischen Pfalz, während acht Jahren, mit Freude und Segen bekleidete, zu politischen Geschäften auf einer der ersten Kanzleistellen in der Schweiz.“[10] Worin die erwähnte Lehrtätigkeit bestand, ist nicht bekannt.[11] Wir erfahren nur, dass Hofmann in der kurpfälzischen Residenzstadt Mannheim Bibliothekar des Fürsten Karl August von Bretzenheim (1768–1823) war, eines unehelichen Sohnes von Kurfürst Karl Theodor.[12] Es heisst auch, er sei Jakobiner geworden und nach Frankreich gegangen. Feststeht, dass er eine Reformierte namens Karoline oder Charlotte heiratete und dass die für Musik, Zeichnen und Malerei begabten Töchter des Paares – Karoline, Amalie (1797–1870) und Charlotte (1801–1819) – reformiert erzogen wurden. Amalie soll in der Schweiz zur Welt gekommen sein.
Sekretär der helvetischen Regierung
1799–1801 war Hofmann – ein ausgezeichneter Stilist – erster deutscher Redaktionssekretär des Vollziehungsdirektoriums der Helvetischen Republik mit Sitz in Bern. Der Pädagoge Johann Heinrich Pestalozzi (1746–1827), welcher 1799–1804 im benachbarten Burgdorf wirkte, erinnerte ihn später an diese Tage, „in denen wir uns so oft sahen und mit wahrem Zutrauen gegenseitig einander viele Teilnahm bezeugten und viele freundschaftliche Stunden durchleben“.[13] Hofmann verbreitete Pestalozzis Lehre in in- und ausländischen Blättern.[14] Mit seinem Amtskollegen Leonard Meister (1741–1811) – einem reformierten Pfarrer – gab er 1799 ein Journal von und für Helvetien heraus, zu dessen Mitarbeitern Heinrich Zschokke (1771–1848) zählte.[15] 1801 plante Hofmann, mit dem Verleger Johann Georg Albrecht Höpfner (1759–1813) eine Helvetische Zeitung zu lancieren.
Leiter der Kantonsschule in Aarau

war das heutige Amthaus.
Hofmann schreibt: „Jemehr meine Hoffnungen, eine Reformation der Menschen durch politische Revolutionen befördert zu sehen, durch meine täglich schlimmere Erfahrungen sank, desto höher stieg mein Glauben an die Verbesserung des Menschengeschlechts durch die pädagogische Umschaffung Pestallozzi’s (sic) (…)“[16] Nach dem Staatsstreich der Föderalisten (Gegner des helvetischen Einheitsstaates) im Oktober 1801 wurde er mit der Organisation der Kantonsschule in Aarau betraut.[17] Die Gründung dieses bis 1813 privaten Instituts ging von Bergdirektor Johann Samuel Gruner (1766–1824)[18] und Seidenbandfabrikant Johann Rudolf Meyer (1768–1825) aus. Das im November veröffentlichte Programm der Schule trägt Hofmanns Unterschrift. Es heisst darin: „(…) sclavische Huldigung gegen fremde Autorität ist der wahre Tod der Vernunft.“ Die Zöglinge sollten „nützliche Glieder eines freyen Staates“ werden. Jedes Kind dürfe sich entwickeln, wie es seinen Anlagen und Neigungen entspreche.[19] Bei der Erziehung werde man „den Winken und Vorschriften der Natur, der weisesten und sichersten Gesetzgeberin folgen“ und nach dem „Stuffengange der Natur“ vorgehen.[20]
Bei der Eröffnung der Schule im Januar 1802 war Hofmann der Hauptredner.[21] Die führende Zeitung der Helvetik nannte ihn „die Seele des Instituts“.[22] Er übernahm die Fächer Philosophie und Rhetorik. Wie er selber schreibt, wurde sein Unterricht in „Menschen-, Sitten- und Pflichtenlehre (…) oft angefochten und verdächtiget“.[23] Er war mit seinem Lehrerkollegen Andreas Moser (1766–1806) befreundet,[24] einem Deisten und angeblichen Illuminaten, der zur Zielscheibe der im April 1802 entmachteten Föderalisten wurde. Im Vorfeld der Konterrevolution vom darauffolgenden September (Stecklikrieg) musste Moser aus Aarau fliehen. Im Oktober verlangte die Standeskommission des Kantons Bern erfolglos auch Hofmanns Ausweisung.[25]
Klassische versus Menschenbildung
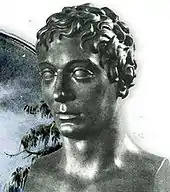
Hofmann war bis 1804 gewählter Präsident der Schulkommission (Lehrerkonferenz). Er bestand darauf, dass sich seine Kollegen an gemeinsam gefasste Entscheidungen hielten. Es kam zu Zwistigkeiten mit Pfarrer Ludwig Rahn (1770–1836), der vor der Gründung der Kantonsschule ein eigenes Erziehungsinstitut in Aarau und die städtische Realschule geleitet hatte.[26] Das System der kollektiven Führung missfiel dem nach dem Ende der Helvetik (1803) eingestellten Altphilologen Luzius Hold (1778–1852). Vom Studium in Halle her an preussisch-autoritäre Verhältnisse gewöhnt, betrieb er die Einsetzung eines Rektors. Als man dieses mit weitreichenden Kompetenzen ausgestattete Amt nicht ihm anvertrauen wollte, erreichte er die Berufung seines erst 25-jährigen Studienfreunds und Fachkollegen Ernst August Evers (1779–1823). Wie der Mathematiker Johann Christian Martin Bartels (1769–1836) und der Theologe Wilhelm Benjamin Gautzsch (1771–1835) sah auch Hofmann in Evers die „Beschränktheit der niederdeutschen Magister“ verkörpert, „die meistens außer ihren griechischen und lateinischen Schulbüchern kaum andere Kenntnisse besäßen“.[27] Vergeblich schlug er vor, den jungen Mann nur zum Rektor der kleinen Abteilung für künftige Akademiker (Humanistische Schule) zu machen, ihn selber aber zu jenem der größeren für Kaufleute (Realschule).[28]
Mit Hold und Evers trat an der Kantonsschule der Neuhumanismus mit seinem klassischen Bildungskanon an die Stelle des auf Menschenbildung abzielenden Erziehungssystems von Pestalozzi. Alle bisherigen Lehrer verliessen die Schule, die Zahl der Schüler sank auf die Hälfte. Als 1805 ein neues Schulprogramm erschien,[29] über das Hofmann nicht informiert worden war, kündigte auch er. Dies, obwohl er erst im Vorjahr ein Haus an der Laurenzenvorstadt samt dem Bürgerrecht von Aarau erworben und ein Pensionat für Kantonsschüler eröffnet hatte. „Als öffentliche Rechtfertigung gegen öffentliche Kränkungen“ verfasste er die Schrift Über Entwicklung und Bildung der menschlichen Erkenntnisskräfte zur Verbindung des Pestallozzischen (sic) Elementarunterrichts mit dem wissenschaftlichen Unterrichte in Realschulen.[30] Darin schonte er seine beiden Kontrahenten nicht. Hold reichte darauf ohne Erfolg eine Verleumdungsklage ein.[31] Evers aber wurde im Prolog seines Fragments der Aristotelischen Erziehungskunst noch weit polemischer als Hofmann. So bezeichnete er es – an diesen gewandt – als überflüssig, „Ihre pädagogische Ignoranz, das armselige Blendwerk Ihrer hohltönenden Phrasen und die Puppeneitelkeit auf nichtige Vorzüge Ihrem Paar Ohren vernehmlicher darzustellen“.[32]
Mitarbeiter Pestalozzis in Yverdon
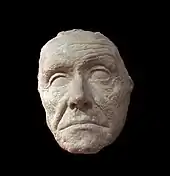
Johann Heinrich Pestalozzi
(Terrakottamaske, 1809).
Hofmann betrieb noch einige Zeit ein privates Erziehungsinstitut in Aarau.[33] 1806–1810 wirkte er in Yverdon (Waadt), wo er ein Pensionat eröffnete, an Pestalozzis Institut unterrichtete und sich um dessen finanzielle Konsolidierung bemühte. Seine Töchter gehörten zu den ersten Schülerinnen der angegliederten Töchteranstalt. Das Haus in Aarau samt dem Bürgerrecht der Stadt verkaufte er 1807 dem Verleger Heinrich Remigius Sauerländer. Im Morgenblatt für gebildete Stände[34] schrieb er über die Einführung der Pestalozzischen Methode in Spanien[35] und Preussen[36], über den in Yverdon praktizierten Kult des Meisters[37], aber auch über ein patriotisches Schützenfest im Kanton Léman[38] – eine Art Gegenstück zum Unspunnenfest der Aristokraten. Hofmann war Mitglied der 1808 gegründeten Schweizerischen Gesellschaft der Erziehung, die sich jeweils in Lenzburg versammelte.[39] 1809/10 wurde er Zeuge der Fehden, die am Institut in Yverdon ausgetragen wurden. Pestalozzi-Biograf Heinrich Morf schreibt: „Hofmann nahm am Streite keinen Anteil, sein zartbesaitetes, liebevolles Gemüth suchte nur Gegenliebe. Die fand er bei Pestalozzi, an dem er mit kindlicher Hingebung und Verehrung hing (…)“[40]
Von Rom nach Neapel

Königin Carolina von Neapel (1814).
1810 unternahm Hofmann eine Reise nach Mülhausen[41], woher mehrere Schüler in Yverdon stammten[42]. Im selben Jahr übersiedelte er mit seiner Familie und dem Pestalozzi-Schüler Joseph Alphons Pfyffer (1791–1812)[43] nach Rom. Seine Töchter sollten sich in der Ewigen Stadt künstlerisch weiterbilden.[44] Doch statt, wie geplant, mehrere Jahre zu bleiben, eröffnete er auf Einladung des Arztes Johann Mayer (1777–1812)[45] und der Erzieherin der Königstöchter, Carolina Filangieri (1750–1828)[46], 1811 eine Pestalozzi-Schule in Neapel. Dort nahm sich die Gattin Joachim Murats (1767–1815)[47], Napoleons jüngste Schwester Carolina (1782–1839), des Erziehungswesens an. Der Erzbischof von Tarent, Giuseppe Capecelatro (1744–1836)[48], der Erzieher der Königssöhne, Amable de Baudus (1761–1822), und der Generalsekretär des Staatsrats, Tito Manzi (1769–1836), unterstützten Hofmann.
Sein Institut wurde im Verlauf von sechs Jahren von 253 Franzosen, Deutschen, Engländern und Neapolitanern besucht.[49] Auch die Lehrerschaft war international zusammengesetzt. Hofmann und Pfyffer übersetzten Pestalozzis Elementarlehre ins Französische und Italienische. Hofmann veröffentlichte Idee generali sulla educazione (Prinzipien der Erziehung). Darin schreibt er: „Le vere basi dell’educazione sono i sentimenti religiosi e morali.“ (Die wahren Grundlagen der Erziehung sind die religiösen und moralischen Gefühle.)[50] Das Ziel seines Instituts bestehe „nel formar uomini cari a Dio ed alla Società“ (in der Heranbildung von Männern, die Gott und der Gesellschaft lieb sind).[51] Nach Pfyffers frühem Tod stiessen die Pestalozzianer Fridolin Baumgartner (1791–1814) und Johannes Schneider (1792–1858)[52] zum Lehrerteam. Als besonders schwierig erwies sich in Neapel der wissenschaftlich verbrämte[53] Kampf der Aufklärer gegen die Selbstbefleckung (Masturbation).[54]
Als die Schule gedieh, kaufte Hofmann zwei Häuser aus säkularisiertem Kirchenbesitz und liess dazwischen einen Saal bauen. Über den Alltag in diesem neuen Domizil schreibt er: „Ueberall war reges, frohes und schaffendes Leben, vom frühesten Morgen, der vom Vesuv herüber mit herrlichem Jubel zur Arbeit rief, bis zum späten Abende, der über St. Elmo seine Erquickungen goß auf den fröhlichen Verein von Jung und Alt, bei gemeinschaftlichen Spielen oder vertraulichen Unterhaltungen im kühlenden Grün himmlisch-duftender Lauben.“[55] Baumgartners Tod versetzte dem Institut dann einen harten Schlag. Beim Untergang des napoleonischen Staatensystems verlor es seine französischen Schüler[56], und 1816 machte der geisttötende Klerikalismus unter der wiederhergestellten Herrschaft der Bourbonen seinen Weiterbestand unmöglich.
Im Kaisertum Österreich

1817 finden wir Hofmann in Wien, wo er Erzieher zweier aus Neapel mitgebrachter Grafen war.[57] Wegen der angegriffenen Gesundheit der jüngsten Tochter[58] übersiedelte er 1818 nach Pest (heute Teil von Budapest). Dort führte er bis 1821 eine k. k. privilegirte Erziehungs- und Unterrichtsanstalt für Töchter aus den gebildeten Ständen. Anlässlich der Eröffnung schrieb der Redaktor der Vereinigten Ofner und Pester Zeitung, Johann Christoph Rösler (1773–1837), über Hofmann: „(…) die edle Humanität und Reife seines geistigen Charakters lebt auch in seinem ganzen Exterieur; seine Gattin und zwey erwachsene Töchter[59] besorgen zugleich mit ihm und unter seiner Leitung das ErziehungsGeschäft (…)“[60] Der ungarische Pestalozzianer János Szabó von Várad (1783–1864) würdigte das Institut in einem Bericht.[61] Hofmann selber veröffentlichte damals Ueber Erziehung und Unterricht.[62] In einer Rezension dieser Schrift wurde er von seinem Konkurrenten Johann Ludwig Folnesics (1780–1823) des „widerchristlichen Deismus“ bezichtigt.[63] Hofmanns wirkliche Einstellung zur Religion erhellt aus seiner nachstehenden Äusserung gegenüber einem Vertreter der Bibelgesellschaft: „(…) ohne den Glauben an die Menschheit ist der Glaube an Christus und der Glaube an Gott ein Hingespinnst (…)“[64]
Die Auflösung des Instituts in Pest hing wohl mit der Heirat der Töchter zusammen. Mit ihrer Familie lebte Karoline fortan in Rom, Amalie in Triest[65] beziehungsweise Görz (Gorizia). Der Gatte der Letzteren, Johann Christoph Ritter, Edler von Záhony (1782–1838), war 1832–1835 Präsident der neu gegründeten Versicherungsgesellschaft Assicurazioni Generali.[66] Hofmann redigierte 1822 am Comer See sein umfangreichstes Werk Beiträge zur Kulturgeschichte Neapels.[67] Teile davon erschienen vorab in Zschokkes Überlieferungen zur Geschichte unserer Zeit.[68] 1823 soll sich der Pädagoge auf einem Landgut (Milchwirtschaftsbetrieb) bei Wien zur Ruhe gesetzt haben.
Werke
- (Mit Leonard Meister:) Journal von und für Helvetien. 12 Nummern, Bern, ab Juli 1799.
- Kantons-Schule in Aarau. (18. November) 1801.
- Neue Anordnungen und verbesserte Einrichtungen in der Kantonsschule zu Aarau. (12. November) 1802.
- Anordnung und Eintheilung der Lehrfächer und Lehrstunden für den Sommerkurs der Kantonsschule in Aarau. (20. Mai) 1803.
- Neueste Anordnung und Eintheilung der Lehrfächer und Lehrstunden in der Kantonsschule in Aarau. (15. September) 1804.
- Über Entwicklung und Bildung der menschlichen Erkenntnisskräfte zur Verbindung des Pestallozzischen (sic) Elementarunterrichts mit dem wissenschaftlichen Unterrichte in Realschulen von Dr. Georg Franz Hofmann. Basel/Aarau, (August) 1805.
- Neue Erziehungsanstalten in Spanien. In: Morgenblatt für gebildete Stände, 9. Februar 1807, S. 136.
- Neujahrs-Feyer im Pestalozzischen Institute zu Iferten (Yverdon). In: Morgenblatt für gebildete Stände, 26. Februar 1807, S. 194 f.
- Das Königsfest in Montcharant (Montcherand), bey Orbe im Kanton Leman, am 13 Juni 1807. In: Morgenblatt für gebildete Stände, 11. Juli 1807, S. 659 f.[69]
- Feyer des Geburtstages Pestalozzi’s in Iferten, am 12 Jänner 1808. In: Morgenblatt für gebildete Stände, 29. Januar 1808, S. 98–100.
- Ueber die Anstalten der preußischen Regierung zu der Einführung der neuern Elementar-Methode. In: Morgenblatt für gebildete Stände, 10. Mai 1809, S. 443 f.
- Idee generali sulla educazione per servir di base all’organizzazione dell’istituto di Giorgio Francesco Hofmann. Napoli, (Settembre) 1812. (Digitalisat)
- Stato scientifico e morale dell’istituto di G. F. Hofmann. Napoli 1814.[70]
- Ueber Erziehung und Unterricht. Ein Wort zur Ankündigung einer in Pesth errichteten k. k. privilegirten Erziehungs- und Unterrichtsanstalt für Töchter aus den gebildeten Ständen. Von Georg Franz Hofmann, Philos(ophiæ) Mag(ister), Mitglied der Pädagogischen Gesellschaft in Lenzburg, vormals Professor an der Cantonsschule des Aargau’s in der Schweitz. Pesth 1818.
- Letztes Wort an die Eltern der Zöglinge und die Freunde der Erziehungs-Anstalt des G. F. Hofmann. Pesth 1821.[71]
- Geschichte einer Pestalozzischen Bildungsanstalt in Neapel. (Als Beitrag zur Sittengeschichte des heutigen Neapels.) In: Heinrich Zschokke (Herausgeber), Überlieferungen zur Geschichte unserer Zeit (Aarau), Jahrgang 1822, S. 451–486.
- Beiträge zur Kulturgeschichte Neapels. In Erzählungen der Schicksale der Erziehungs- und Bildungsanstalt des Georg Franz Hofmann. Aarau 1823. (Digitalisat)
Quellen und Darstellungen
- Feyerliche Eröffnung der Kantons-Schule in Aarau. Zum Druke befördert von der neuen literärischen Gesellschaft in Aarau. (6. Januar) 1802.
- Ernst August Evers: Organisation der Kantonsschule zu Aarau. 1805.
- Derselbe: Prologus galeatus. In: Fragment der Aristotelischen Erziehungskunst, als Einleitung zu einer Prüfenden Vergleichung der antiken und modernen Pädagogik. Nebst einem Beitrag zur Geschichte der Kantonsschule in Aarau, Aarau 1806, S. III–XXVI.
- Morgenblatt für gebildete Stände. Tübingen 1807 ff.
- Franz Xaver Bronner: Die Kantonsschule in Aarau. In: Der Kanton Aargau. 2. Band, St. Gallen/Bern 1844, S. 11–17.
- Heinrich Morf: Eine Pestalozzi’sche Anstalt in Neapel. 1811–1816. In: Paedagogium, Monatsschrift für Erziehung und Unterricht, 11. Jahrgang, Leipzig 1889, S. 712–732; auch leicht verändert als Separat-Abdruck aus dem „Landboten“ und Tagblatt der Stadt Winterthur, Winterthur 1897.
- Gustav Toepke (Bearbeiter): Die Matrikel der Universität Heidelberg. 4. Theil, Heidelberg 1903.
- Johann Heinrich Pestalozzi: Sämtliche Briefe. Kritische Ausgabe. 14 Bände, Zürich 1946–1995.
- Leonhard Friedrich/Sylvia Springer: Johann Heinrich Pestalozzi. Sämtliche Werke und Briefe. Kritische Ausgabe. Registerband 1. Zürich 1994.
- Rebekka Horlacher/Daniel Tröhler (Herausgeber): Sämtliche Briefe an Johann Heinrich Pestalozzi. Kritische Ausgabe. 6 Bände, Zürich 2009–2015.
- Andreas Steigmeier: Hofmann, Georg Franz. In: Historisches Lexikon der Schweiz.
Einzelnachweise und Anmerkungen
- Der festlich begangene Namenstag an St. Georg 1815, den Hofmann (1823), S. 198–201, schildert, war wohl zugleich sein 50. Geburtstag.
- Wiener Zeitung: Verstorbene zu Wien. 20. März 1849, abgerufen am 19. Januar 2021 (deutsch).
- Hofmann (1823), S. 97 f., 277, 292, 297.
- Steigmeier.
- Toepke, S. 327. 1782 war er logicus, 1784 physicus.
- Richard van Dülmen: Der Geheimbund der Illuminaten, Stuttgart-Bad Cannstatt 1975, S. 269 f. Mieg gewann Pestalozzi für den Geheimbund. 1797 vertrat er das Projekt einer süddeutschen Republik. Derselben Theologendynastie gehörte Johann Elias Mieg (1770–1842) an, der 1807–1810 in Yverdon wirkte und Hofmann 1811 bei der Etablierung in Neapel unterstützte.
- Hofmann (1805).
- Hofmann (1818).
- Im Album promotorum in facultate philosophica ex parte catholicorum 1705–1805 der Universität Heidelberg klafft im Zeitraum 1771–1789 eine Lücke. (Toepke, S. 519/Anm. 1.)
- Hofmann (1805), S. IV.
- Der Weltpriester Georg Franz Hofmann, welcher 1791 in Mannheim eine lateinische Sprachlehre veröffentlichte, dürfte mit dem späteren Pfarrer von Feudenheim († 1816) identisch sein.
- Augsburgische Ordinari Postzeitung, 22. Juli 1799.
- An Hofmann (gegen Ende 1805), in: Pestalozzi, 5. Band (1961), S. 98.
- Hofmann (1805), S. V.
- Das Vollziehungsdirektorium der Helvetischen Republik übernahm für zwölf Wochen die Druck- und Versandgebühren.
- Hofmann (1805), S. V f.
- Morf (1889), S. 712/Anm.; Morf (1897), S. 1.
- Gruner heiratete 1817 die verwitwete Schwester von Hofmanns Landsmann Philipp Franz von Walther.
- Kantons-Schule in Aarau, S. 1.
- Kantons-Schule in Aarau, S. 2 f.
- Feyerliche Eröffnung der Kantons-Schule in Aarau, S. 14–29.
- Der Republikaner (Luzern), 16. Januar 1802, S. 17, vergleiche 4. Februar 1802, S. 45/Anm. 1.
- Hofmann (1805), S. XVII inklusive Anm.
- Christian Roedel: Pestalozzi und Graubünden. Winterthur 1960, S. 143.
- Standeskommission von Bern an Regierungsstatthalter David Rudolf Bay, 1. Oktober 1802. In Johannes Strickler (Bearbeiter): Amtliche Sammlung der Acten aus der Zeit der Helvetischen Republik, 9. Band, Bern 1903, S. 71; von Ernst Jörin: Der Aargau 1798–1803 (Argovia 42), Aarau 1929, S. 227/Anm. 66, falsch interpretiert.
- Franz Xaver Bronner (1758–1850), ab 1804 Lehrer für Mathematik und Naturwissenschaften: „(…) die oft erneuerten Gezänke auf den Hausgängen gaben Lehrern und Schülern Aergerniß.“ (Bronner, S. 13.) Vergleiche Evers (1806), S. V, XV, XVI inklusive Anm.
- Bronner, S. 14.
- Evers (1806), S. XIX.
- Evers (1805).
- Hofmann (1805), S. III.
- Kaiserlich und Königlich bairische privilegirte Allgemeine Zeitung (Ulm), 28. März 1806, S. 347.
- Evers (1806), S. XXIV. Vergleiche vom selben Autor: Über die Schulbildung zur Bestialität. Aarau 1807.
- Evers (1806), S. VII/Anm.
- Bernhard Fischer (Bearbeiter): Morgenblatt für gebildete Stände (…) Register der Honorarempfänger/Autoren und Kollationsprotokolle. München 2000, S. 304.
- Hofmann (9. Februar 1807).
- Hofmann (10. Mai 1809).
- Hofmann (26. Februar 1807), Hofmann (29. Januar 1808).
- Hofmann (11. Juli 1807).
- Hofmann (1818), Titel.
- Morf (1889), S. 712; Morf (1897), S. 2.
- Vicki Müller-Lüneschloß: Über das Verhältnis von Natur und Geisterwelt. Stuttgart-Bad Cannstatt 2012, S. 77.
- Vier Köchlin, drei Dollfuss und zwei Heilmann.
- Sohn des früheren Mitglieds des Vollziehungsdirektoriums der Helvetischen Republik und Redaktors des Freyheitsfreunds Alphons Pfyffer (1753–1822).
- In Rom erwarteten ihn die befreundeten Maler Carl Grass (1767–1814) und Ludwig Vogel (1788–1879), Letzterer ein ehemaliger Schüler (Feyerliche Eröffnung der Kantons-Schule in Aarau, S. 11.) Hofmann lernte auch andere Künstler kennen, so den Maler Gottlob Friedrich Steinkopf (1778–1860) und den Kirchenmusiker Giuseppe Sirletti (1775–1834), die seine Töchter unterrichteten. Pietro Giuntotardi (1764–1842) lehrte die Reisegruppe Italienisch.
- Nachruf in: Süd-Deutsche Miscellen für Leben, Literatur und Kunst, Karlsruhe, 24. Oktober 1812, S. 347 f.
- Die gebürtige Ungarin Carolina Gräfin Frendel, Witwe des Juristen und Philosophen Gaetano Filangieri (1752–1788).
- Seit 1808 König von Neapel.
- Einer der wenigen überlebenden Exponenten der Parthenopäischen Republik von 1799, 1808/09 Innenminister, erster Almosenier der Königin. 1811 hatte eine von Capecelatro präsidierte Kommission ein Projekt für eine Verbesserung der öffentlichen Schulen veröffentlicht, das aber angesichts der herrschenden politischen Spannungen keine Chance auf Verwirklichung hatte.
- Hofmann (1823), S. 40, 309.
- Hofmann (1812), S. VIII.
- Hofmann (1812), S. 62.
- Verliess Neapel 1815. Später bernischer Regierungsrat und Nationalrat.
- Vergleiche Simon-Auguste Tissot: L’Onanisme; ou dissertation physique, sur les maladies produites par la Masturbation. Lausanne 1755 (richtig: 1760).
- Vergleiche Hofmann (1823), S. 59–64, 87–89.
- Hofmann (1823), S. 155 f.
- Neapel wurde zunächst von den Österreichern besetzt, was Hofmann eine Gnadenfrist verschaffte.
- Samuel Flick an Pestalozzi, Wien, 4. Oktober 1817. In: Horlacher/Tröhler, Band 5, S. 132.
- Hofmann (1823), S. 27/Anm., 312/Anm.
- Die kranke Charlotte wurde nicht mitgezählt. Ein Gedicht auf den Tod der 18-jährigen findet sich in: Gemeinnützige Blätter zur Belehrung und Unterhaltung als gleichzeitiger Begleiter der vereinigten Ofner und Pester Zeitung, Ofen (Buda), 30. September 1819, S. 620
- Gemeinnützige Blätter zur Belehrung und Unterhaltung als gleichzeitiger Begleiter der vereinigten Ofner und Pester Zeitung, Ofen (Buda), 27. August 1818, S. 549–551.
- Nevelést illető Intézet (Ein Erziehungsinstitut). In: Tudományos Gyűjtemény (Sammlung der Wissenschaften), Buda, 1818, IX. Band, S. 115–122.
- Hofmann (1818).
- Zeitblätter für Freunde wahrer Menschenbildung, Ofen (Buda), 11.–25. Dezember 1818, S. 374 f., 381–383, 397–399, 407, Zitat: S. 375.
- Hofmann (1823), S. 246 f.
- Hofmann (1823), S. 312/Anm.
- Eugen Ritter Freiherr von Záhony: Chronik und Stammbaum der im Jahre 1829 in Österreich mit dem Prädikat „Von Záhony“ geadelten Familie Ritter aus Frankfurt a. M. Brünn (Brno) 1915, S. 1, 6–12, Stammbaum.
- Hofmann (1823), S. 20.
- Hofmann (1822).
- Vergleiche Adolphe Joanne: Itinéraire descriptif et historique de la Suisse, Paris 1841, S. 185.
- Hofmann (1823), S. 191 f.; Morf (1889), S. 727; Morf (1897), S. 25.
- Tudományos Gyűjtemény, wie oben, 1821, XI. Band, S. 121.