Adam Lonitzer
Adam Lonitzer (latinisiert Adamus Lonicerus) (* 10. Oktober 1528 in Marburg; † 29. Mai 1586 in Frankfurt am Main) war ein deutscher Naturforscher, Arzt, Botaniker und Verfasser eines bedeutenden Kräuterbuchs. Sein offizielles botanisches Autorenkürzel lautet „Lonitzer“.

Leben und Wirken
Adam Lonitzer, der Sohn des Marburger Altphilologen Johann Lonitzer, wurde im Alter von 13 Jahren Baccalaureus und studierte anschließend an der Universität Marburg Philosophie und Medizin. 1545 erwarb er den Magister artium. Anschließend unterrichtete er für ein Jahr am städtischen Gymnasium in Frankfurt am Main unter dem Rektor Jakob Micyllus, danach in Friedberg alte Sprachen.[1] Von 1545 bis 1553 wandte er sich medizinischen Studien in Frankfurt und Mainz zu. 1553 wurde er an der Universität Marburg Professor für Mathematik. 1554 wurde er dann in Marburg zum Dr. med. promoviert[2] und begann als Stadtphysikus in Frankfurt am Main tätig zu werden. Ebenfalls 1554 heiratete er Magdalena, die Tochter des Frankfurter Buchdruckers Christian Egenolff.[3]
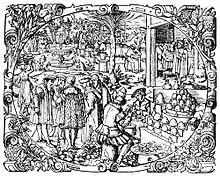
Ab 1550 beschäftigte sich Lonitzer mit Kräuterbüchern, wobei er die Pflanzen vor allem unter medizinisch-pharmazeutischen Aspekten beschrieb. Er stellte aus älteren Kräuterbüchern Abbildungen zusammen und beschrieb die Arten, so unter anderem ihre Erkennungsmerkmale und für verbreitete einheimische Pflanzenarten auch Standorte. Gedruckt wurden Lonitzers Bücher von seinem Schwiegervater Egenolffs. Nach dessen Tod von seinen Erben.[3]
Die Pflanzenabbildung seines Kräuterbuchs stammen zum großen Teil aus dem Kräuterbuch von Eucharius Rößlin dem Jüngeren, das wiederum Illustrationen aus Otto Brunfels’ Herbarum vivae eicones und solche vom Zeichner der Drusilla[4] enthält.[5]
Zu vielen der Pflanzen und Pilze, die er beschrieb, gibt es Hinweise zu praktischen Anwendungen. Im Kräuterbuch Lonitzers findet sich unter anderem die erste Darstellung von Claviceps-Sclerotien (Mutterkörner).[6] Unter anderem beschrieb er auch Geräte und Verfahren etwa zum Destillieren von Branntwein, die er wiederum einem Buch von Hieronymus Brunschwig entnahm.[7]
Sein 1557 erstmals erschienenes Kreuterbuch in der Groß-Gart-Tradition[8] (Drittredaktion, Klasse b3) des Gart der Gesundheit wurde bis 1783 in 27 Auflagen gedruckt.[9] Der Arzt und Herausgeber Peter Uffenbach (1566–1635), der auch das Kräuterbuch des Pedanios Dioskurides[10] herausgab, erweiterte Lonitzers Werk und bezog Quellen wie Ruellius[11] in seine Ausgabe ein.
Ehrungen
Charles Plumier benannte ihm zu Ehren eine Gattung Lonicera.[12] Carl von Linné übernahm später diese Gattung nicht, sondern stellte sie zur Gattung Loranthus der Pflanzenfamilie der Riemenblumengewächse (Loranthaceae).[13][14]
Linné benannte nach ihm die Gattung Lonicera[15] der Pflanzenfamilie der Geißblattgewächse (Caprifoliaceae).
Schriften (Auswahl)
- Arithmetices brevis introductio. Christian Egenolff, Frankfurt am Main 1551.
- Naturalis historiae opus novum. 2 Bände, 1551/1555 (Online-Edition im Projekt CAMENA).
- Neuausgabe: Botanicon: plantarum historiae, cum earundem ad vivum artificiose expressis iconibus, tomi duo. Christian Egenolff, Frankfurt am Main 1565.
- Kreuterbuch: künstliche Conterfeytunge der Bäume, Stauden, Hecken, Kreuter, Getreyde, Gewürtze, mit eigentlicher Beschreibung derselben Namen, in sechserley Spraachen, nemlich, griechisch, latinisch, italianisch, frantzösisch, teutsch und hispanisch, vnd derselben Gestalt, natürlicher Krafft vnd Wirckung ; sampt künstlichem vnd artlichem Bericht deß Destillierens ; item von fürnembsten Gethieren der Erden, Vögeln, vnd Fischen ; deßgleichen von Metallen, Ertze, Edelgesteinen, Gummi, vnd gestandenen Säfften. Christian Egenolffs Erben, Frankfurt am Main 1557; weitere Auflagen ebenda: 1560 (Digitalisat); 1564 (Digitalisat); 1573 (Digitalisat); 1578 (Digitalisat); 1582 (Digitalisat); 1593 (Digitalisat); Kreuterbuch 1598 (Digitalisat); 1604 (Digitalisat)
- Bearbeitung durch Peter Uffenbach 1630 (Digitalisat); 1678 (Digitalisat); 1703 (Digitalisat)
- Ulmer Ausgabe von 1679 (Groß-Gart-Fassung b2): Kraͤuterbuch. Künstliche Conterfeytunge der Baͤeume, Stauden, Hecken, Kraͤuter, Getreyd, Gewuͤertze […]. Hrsg. von Peter Uffenbach, Ulm an der Donau 1679; Neudruck (Leipzig 1934 und bei) Konrad Kölbl, (Grünwald bei) München 1962.
- Weitere Bearbeitung durch Balthasar Erhrhart 1737 (Digitalisat); letzte Ausgabe 1783 (Digitalisat)
- Bearbeitung durch Peter Uffenbach 1630 (Digitalisat); 1678 (Digitalisat); 1703 (Digitalisat)
- Ordnung für die Pestilentz. Christian Egenolff, Frankfurt am Main 1576.
- Arithmetices Brevis et Utilis Introductio. Francofurti ad Moenum 1579 (Online-Ausgabe der Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden).
Literatur
- Karl Mägdefrau: Lonicerus, Adam. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 15, Duncker & Humblot, Berlin 1987, ISBN 3-428-00196-6, S. 147 f. (Digitalisat).
- F. W. E. Roth. Die Botaniker Eucharius Rösslin, Theodor Dorsten und Adam Lonicer 1526-1586. Zentralblatt für Bibliothekswesen Bd. 19 (1902), Heft 6, S. 271–286 Digitalisat und Heft 7, S. 338–345 Digitalisat
- Wilhelm Stricker: Lonicerus, Adam. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 19, Duncker & Humblot, Leipzig 1884, S. 157 f.
Weblinks
- Autoreintrag und Liste der beschriebenen Pflanzennamen für Adam Lonitzer beim IPNI
- Werke von und über Adam Lonitzer in der Deutschen Digitalen Bibliothek
- Lonicerus, Adam. Hessische Biografie. (Stand: 29. Dezember 2019). In: Landesgeschichtliches Informationssystem Hessen (LAGIS).
- Lonicerus, Adam im Frankfurter Personenlexikon
Einzelnachweise
- Friedrich Wilhelm Strieder, Grundlage zu einer Hessischen Gelehrten- und Schriftsteller-Geschichte, seit der Reformation bis auf gegenwärtige Zeiten. 8. Bd., Kassel 1788, (Leu-Meur.), S. 86.
- Volker Zimmermann: Lonicerus, Adam. In: Werner E. Gerabek, Bernhard D. Haage, Gundolf Keil, Wolfgang Wegner (Hrsg.): Enzyklopädie Medizingeschichte. De Gruyter, Berlin/New York 2005, ISBN 3-11-015714-4, S. 863 f.; hier: S. 863.
- Karl Eugen Heilmann: Kräuterbücher in Bild und Geschichte. 2. Auflage, Verlag Konrad Kölbl, München-Allach 1973. S. 31f. und S. 220ff.
- Claus Nissen: Die Botanische Buchillustration. Ihre Geschichte und Bibliographie. 2. Auflage, mit Supplement, Stuttgart 1966, Band 2, S. 154.
- Wolfgang Schiedermair: Die „Meelbyrn, Paliurus“ in Adam Lonitzers „Kreuterbuch“ (1679). Zur Kenntnis von X Sorbopyrus auricularis (Kroop.) Schneid. – Hagebuttenbirne. In: Medizinhistorische Mitteilungen. Zeitschrift für Wissenschaftsgeschichte und Fachprosaforschung. Band 34, 2015 (2016), S. 87–96, hier: S. 88 f.
- Martin Stohler: LSD und sein langer Trip zurück ins Labor in: TagesWoche vom 20. April 2018.
- Siehe: Brunschwig, Hieronymus: Das distilierbuch. Das Buch der rechten kunst zu Distilieren unnd die wasser zu brennen. Straßburg: J. Grüninger 1515. CXXX Blätter, Titelholzschnitt, 239 Textholzschnitte. 4. Ausgabe.
- Gundolf Keil: „Gart“, „Herbarius“, „Hortus“. Anmerkungen zu den ältesten Kräuterbuch-Inkunabeln. In: Gundolf Keil (Hrsg.): „gelêrter der arzenîe, ouch apotêker“: Beiträge zur Wissenschaftsgeschichte. Festschrift Willem F. Daems. Wellm, Pattensen 1982 (= Würzburger medizinhistorische Forschungen. Band 24). ISBN 3-921456-35-5, S. 589–635, hier: S. 611–613.
- Johannes Gottfried Mayer: Die Wahrheit über den Gart der Gesundheit (1485) und sein Weiterleben in den Kräuterbüchern der Frühen Neuzeit. In: Sabine Anagnostou, Florike Egmond und Christoph Friedrich (Eds.): A passion for plants: materia medica and botany in scientific networks from the 16th to 18th centuries. (= Quellen und Studien zur Geschichte der Pharmazie, Bd. 95) Stuttgart 2011. ISBN 978-3-8047-3016-8, S. 119–128.
- Pedacii Dioscoridis Anazarbaei Kraeuterbuch […]. Ins Deutsche übersetzt von Johannes Danzius. Frankfurt am Main (Petrus Uffenbach) 1610; Neudruck Grünwald bei München 1964.
- Wolfgang Schiedermair: Die „Meelbyrn, Paliurus“ in Adam Lonitzers „Kreuterbuch“ (1679). Zur Kenntnis von X Sorbopyrus auricularis (Kroop.) Schneid. – Hagebuttenbirne. In: Medizinhistorische Mitteilungen. Zeitschrift für Wissenschaftsgeschichte und Fachprosaforschung. Band 34, 2015 (2016), S. 87–96, hier: S. 89 f.
- Charles Plumier: Nova Plantarum Americanarum Genera. Leiden 1703, S. 26.
- Carl von Linné: Critica Botanica. Leiden 1737, S. 93.
- Carl von Linné: Genera Plantarum. Leiden 1742, S. 151.
- Carl von Linné: Genera Plantarum. Leiden 1742, S. 75.