Hunain ibn Ishāq
Abū Zaid Hunain ibn Ishāq al-ʿIbādī (arabisch أبو زيد حنين بن إسحاق العبادي, DMG Abū Zaid Ḥunain bin Isḥāq al-ʿIbādī; * 808 in Hira im heutigen Irak; † 873 in Bagdad) war ein christlich-arabischer Gelehrter, Übersetzer und Arzt. Sein latinisierter Name lautet Johannitius. Er verfasste das älteste arabische Lehrbuch der Augenheilkunde.
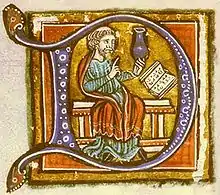
Leben
Nach seinem Medizinstudium in Bagdad, wo Ḥunain ibn Isḥāq mit 16 Jahren ein wissbegieriger[1] Schüler von Yuhanna ibn Masawaih (ebenfalls ein nestorianischer Christ) war, unternahm er eine Studienreise nach Alexandria in Ägypten, wo er Griechisch lernte. In Basra studierte er die arabische Sprache. Als nestorianischer Christ beherrschte er die syrische Sprache.
Nach seiner Rückkehr nach Bagdad arbeitete er im Haus der Weisheit in Bagdad, einem kulturellen Zentrum mit der wichtigsten damaligen Übersetzerschule, die durch den Kalifen al-Ma'mũn gefördert wurde.[2] Im Auftrag von Yũhannã ibn Mãsawaih reiste ibn Ishãq mit Kollegen nach Syrien, Palästina und Ägypten, um dort antike Manuskripte der griechischen Wissenschaften, insbesondere Texte von Galenos, zu erwerben. Im Haus der Weisheit übersetzten er und seine Studenten die meist syrischen Versionen der klassischen griechischen Texte in die Arabische Sprache. Dadurch wurden diese Werke in der Arabischen Welt bekannt. Seine Übersetzungen zeichnen sich durch ihre hohe Qualität aus. Insbesondere sind seine Übersetzungen von Galens Werken aus dem Griechischen (zum Teil auch aus dem Alt-Aramäischen)[3] ins Arabische hervorzuheben, deren griechische Originalmanuskripte verloren gegangen sind. Später wurde er auf den Posten des Chefarztes am Hofe des Kalifen al-Mutawakkil berufen; eine Position, die er bis zu seinem Lebensende innehatte. Zwischenzeitlich ließ ihn der Kalif ins Gefängnis sperren, da er sich weigerte, ein Gift herzustellen, welches für die Ermordung eines Feindes des Kalifen gedacht war.
Hunain ibn Ishāq war auch Autor von etwa 100 eigenen Büchern, insbesondere zu erwähnen ist sein zehngliedriges Werk über Augenheilkunde, welches in Salerno von Konstantin von Afrika lateinisch bearbeitet und als Liber de oculis (Constantini Africani)[4] zur Grundlage der an abendländischen Hochschulen gelehrten Augenheilkunde wurde.[5] Ebenfalls zu nennen ist ein von ihm stammendes Griechisch-Syrische Wörterbuch. Sein Steinbuch (auch Steinbuch des Aristoteles) gehört zu den ältesten erhaltenen Chemie-Büchern und die älteste arabische Handschrift über Mineralogie und baut auf arabischen und spanischen Gelehrten auf. Es werden rund 70 Mineralien beschrieben und die Gewinnung von Metallen beschrieben (Gold, Silber, Blei, Kupfer, Herstellung von Messing, Quecksilber). Er benennt Quecksilber und Grünspan als Gifte.
Ohne die Übersetzungsarbeiten Hunain ibn Ishaqs, aber auch durch seine eigenen Bücher (z. B. die medizinische Isagogik nach Galen und die Augenheilkunde) wären die Werke der antiken Wissenschaften der Nachwelt nicht erhalten geblieben und das damalige Wissen nicht erweitert worden. Durch die von ihm geprägten Fachtermini wurde die arabische Sprache erst zur Wissenschaftssprache. Seine Übersetzungsmethoden sind bis heute anerkannt.
Sein Sohn Ishāq ibn Hunain und der Sohn Hubayš Ibn al-Hasan al-A‘sam al-Dimašqī († 888) seiner Schwester waren seine engsten Mitarbeiter bei den Übersetzungen, insbesondere der philosophischen Quellen. Laut der Enzyklopädie Kitab al-Fihrist des Ibn al-Nadim († 998) hat Hunain Platons Politeia und Nomoi übersetzt, außerdem sein Sohn den Sophistes. Mit seinen Mitarbeitern soll Hunain auch Werke von Hippokrates und mathematische Werke von Euklid und Archimedes, Werke der Logik von Aristoteles und Platons Timaios übersetzt haben. Einige von Hunains Werken wurden von Moses ibn Tibbon ins Hebräische übersetzt.
Siehe auch
- Gabriel ibn Bochtischu († 828), Mediziner und Förderer von Übersetzungen griechischer wissenschaftlicher Werke.
Schriften
- Hunayn ibn Ishâq al-‘Ibadi: Isagoge Joannitii in tegni Galieni primus liber medicine, Leipzig: W. Stöcket, 1497.
- Hunain ibn Ishaq: Isagoge sive introductio Johannitii in artem parvam Galeni de medicina speculativa, Argentorati 1534.
- Honein ibn Ishâk. Sinnsprüche der Philosophen. Nach der hebräischen Übersetzung Charisi's ins Deutsche übertragen und erläutert von A. Loewenthal. Berlin: S. Calvary, 1896
- Karl Merkle, Die Sittensprüche der Philosophen „Kitab adab al-falásifa“ von Honein Ibn Ishaq (Leipzig, 1921).
- Gotthelf Bergsträsser (Hrsg.): Ḥunain ibn Isḥāq Über die syrischen und arabischen Galen-Übersetzungen. Leipzig 1925 (= Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes. Band 17, 2).
- Gotthelf Bergsträsser: Ḥunain ibn Isḥāq und seine Schule. Sprach- und literaturgeschichtliche Untersuchungen zu den arabischen Hippokrates- und Galen-Übersetzungen. Leiden 1913.
- Gotthelf Bergsträsser: Neue Materialien zu Ḥunain ibn Isḥāq’s Galenbibliographie. Leipzig 1932 (= Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes. Band XIX, 2).
- Zehn Abhandlungen über das Auge. S. Max Meyerhof, The Book of the Ten Treatises on the Eye Ascribed to Hunayn ibn-Ishaq (809–877 A.D.).The Earliest existing Systematic Textbook on Ophthalmology, trans. and ed., Cairo: Government Press, 1928.
- Fragen über das Auge
- Das Buch der Farben
- Griechisch-Syrisches Wörterbuch
- Kitab idrāk haqīqat al-diyāna. Ed. und französische Übersetzung von Louis Cheikhô in: Carl Bezold (Hg.): Orientalische Studien Theodor Nöldeke zum siebzigsten Geburtstag. Erster Band. Gießen 1906. Neue Edition: Samir Khalil Samir, Maqālat Hunayn Ibn Ishāq fī „kayfiyyat idrāk haqīqat al diyāna“, in: al-Mašriq 71 (1997), 345–363 (ar) und 565–566 (frz. Abstract)
- Kitāb al-ʿAšr maqālāt fī l-ʿain.[6]
- Das Steinbuch des Aristoteles, u. a. herausgegeben von Julius Ruska (Untersuchungen über das Steinbuch des Aristoteles, Heidelberg 1911)
Literatur
- Gotthelf Bergstraesser, Hunain ibn Ishaq und seine Schule. Sprach- und literaturgeschichtliche Untersuchungen zu den arabischen Hippokrates- und Galenübersetzungen, Leiden 1913.
- G. Gabriel, „Hunayn“, in: Isis 4 (1924), 282–292.
- Max Meyerhof, „New Light on Hunain Ibn Ishaq and his Period“, in: Isis 8 (1926), 685–724.
- Gotthard Strohmaier, „Hunain ibn Ishaq und die Bilder“, in: Klio 1965, 525–536.
- Gotthard Strohmaier, „Hunain ibn Ishaq“, in: Encyclopaedia of Islam (Leiden: Brill), 2d Ed. 3 (1967), 578–581.
- Manfred Ullmann, Die Medizin im Islam, Handbuch der Orientalistik, Abteilung I, Ergänzungsband vi, Abschnitt 1 (Leiden: E.J. Brill, 1970), pp. 115–118.
- Fuat Sezgin, Geschichte des arabischen Schrifttums, Band 3:Medizin-Pharmazie-Zoologie-Tierheilkunde bis ca 430 H. (Leiden: E.J. Brill, 1970), pp. 247–256.
- Samir Khalil Samir, حُنَين بن إسحق والخليفة المأمون (813–833 م)، في: صديق الكاهن 11/3 (1972) 193–198.
- Hunayn ibn Ishaq. Collection d'articles publiée à l'occasion du onzième centenaire de sa mort, Arabica 21 (1975), 229–330.
- Hans Daiber, Ein Kompendium der aristotelischen Meteorologie in der Fassung des Hunain ibn Ishaq, Amsterdam 1975.
- Peter Kawerau, Christlich-arabische Chrestomathie aus historischen Schriftstellern des Mittelalters, coll. Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium 385, Louvain 1977, 54–64.
- Samir Khalil Samir, SJ et Paul Nwyia, sj, Une correspondance islamo-chrétienne entre Ibn al-Munağğim, Hunayn Ibn Ishāq et Qustā Ibn Lūqā. Introduction, texte et traduction, in: „Patrologia Orientalis“, t. 40, fasc. 4 = nº 185 (Turnhout: Brepols, 1981), 205 pages in-4°.
- Georges Ch. Anawati und Albert Zaki Iskandar, „Hunayn ibn Ishaq“ in: Dictionary of Scientific Biography, vol. 15 (New York: American Council of Learned Societies and Charles Scribner's Sons, 1980), pp. 230–249.
- Ursula Weisser, „Noch einmal zur Isagoge des Johannicius: Die Herkunft des lateinischen Lehrtextes“, in: Sudhoffs Archiv 70 (1986), 229–235.
- Samir Khalil Samir, مقالة ”في الآجال“ لِحُنَين بن إسحق » ، في: المشرق 65 (1991) 403–425
- Sebastian Brock, „The Syrian Background to Hunayn's Translation Techniques“, in: ARAM 3 (1991).
- Samir Khalil Samir, „Un traité perdu de Hunayn Ibn Ishāq retrouvé dans la „Somme“ d’Ibn al-‘Assāl“, in: ARAM 3 (1991) 171–192.
- Mauro Zonta, „Ibn al-Tayyib, Zoologist and Hunayn ibn Ishaq's Revision of Aristotle's De Animalibus – New Evidence from the Hebrew Tradition“, in: ARAM 3 (1991).
- Gregg De Young, Ishaq ibn Hunayn, Hunayn ibn Ishaq, and the third Arabic translation of Euclid's ‘Elements’, in: Historia Mathematica 19 (1992), 188–199.
- Galen, Galen on medical experience: First edition of the Arabic version with English translation (from Hunayn al-‘Ibadi’s Syriac version), Oxford: Wellcome Institute, 1994.
- Dimitri Gutas, Greek Thought, Arabic Culture: The Graeco-Arabic Translation Movement in Baghdad and Early ‘Abbasid Society (2nd-4th/8th-10th centuries) (London: Routledge, 1998).
- Samir Khalil Samir, Hunayn ibn Ishāq, Fī l-A‘mār wa-l-Ājāl, coll. « Al-Fikr al-‘Arabī al-Masīhī » 3 (Beyrouth: Dār al-Mašriq, 2001), 60 pages. = حنين بن إسحق ، في الأَعمار والآجال. تقديم وتحقيق الأَب سمير خليل سمير اليسوعيّ ، سلسلة « الفكر العربيّ المسيحيّ – موسوعة المعرفة المسيحيَّةّ » 3.
- Wilhelm Baum: (Abu Zaid) Hunain Ibn Ishaq (ibn Sulaiman ibn Aiyub al-Ibadi). In: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (BBKL). Band 22, Bautz, Nordhausen 2003, ISBN 3-88309-133-2, Sp. 589–593.
- F. Wüstenfeld: Arabische Ärzte (15–16, 1840).
- L. Leclere: Medecine arabe (vol. 1, 99–102, 1876)
- G. C. Anawati, et al: Hunain ibn Ishāq. In: Charles Coulston Gillispie (Hrsg.): Dictionary of Scientific Biography. Band 15, Supplement I: Roger Adams – Ludwik Zejszner and Topical Essays. Charles Scribner’s Sons, New York 1978, S. 230–249.
Weblinks
- Literatur von und über Hunain ibn Ishāq im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- John J. O’Connor, Edmund F. Robertson: Abu Zayd Hunayn ibn Ishaq al-Ibadi. In: MacTutor History of Mathematics archive.
Einzelnachweise
- Friedrun R. Hau: Ḥunain ibn Isḥāq. In: Werner E. Gerabek, Bernhard D. Haage, Gundolf Keil, Wolfgang Wegner (Hrsg.): Enzyklopädie Medizingeschichte. De Gruyter, Berlin/ New York 2005, ISBN 3-11-015714-4, S. 643.
- Wolfgang U. Eckart: Geschichte der Medizin. Springer, Berlin/Heidelberg 1990; zu Hunain ibn Ishāq und al-Ma'mũn S. 80 f. ISBN 3-540-52845-8; 3. Auflage ebenda 1998, S. 102. ISBN 3-540-57678-9.
- Friedrun R. Hau: Sergios von Resaina. In: Werner E. Gerabek, Bernhard D. Haage, Gundolf Keil, Wolfgang Wegner (Hrsg.): Enzyklopädie Medizingeschichte. De Gruyter, Berlin/ New York 2005, ISBN 3-11-015714-4, S. 1322.
- Carl Hans Sasse: Geschichte der Augenheilkunde in kurzer Zusammenfassung mit mehreren Abbildung und einer Geschichtstabelle (= Bücherei des Augenarztes. Heft 18). Ferdinand Enke, Stuttgart 1947, S. 30.
- Gundolf Keil: „blutken – bloedekijn“. Anmerkungen zur Ätiologie der Hyposphagma-Genese im ‚Pommersfelder schlesischen Augenbüchlein‘ (1. Drittel des 15. Jahrhunderts). Mit einer Übersicht über die augenheilkundlichen Texte des deutschen Mittelalters. In: Fachprosaforschung – Grenzüberschreitungen. Band 8/9, 2012/2013, S. 7–175, hier: S. 8.
- Manfred Ullmann: Die Medizin im Islam (= Handbuch der Orientalistik. Erste Abteilung, Ergänzungsband VI, 1). Leiden/Köln 1970, S. 205 f. (zu ‚The book of the Ten Treatises of the Eye‘).