Die Rose (Walser)
Die Rose ist ein Band Essays von Robert Walser, im Februar 1925 bei Ernst Rowohlt in Berlin erschienen.
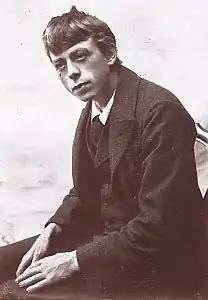
In diesem letzten Buch, das Walser noch selber zusammengestellt hat, werden literarische und andere menschliche Bemühungen mehr bitter-ironisch als humoristisch betrachtet.
Genre
Wilpert kategorisiert die siebenunddreißig kurzen Texte Walsers als Essays.
Greven bezeichnet diese Sammlung als Miniaturen, Kurzgeschichten sowie literarische und humoristische Betrachtungen. Er nennt jene Exkurse, Parabeln, aphoristischen Gedanken und Anspielungen eine höchst originelle Kulturkritik.[1]
Eine Ohrfeige
In Eine Ohrfeige und Sonstiges schreibt Walser, er sei schon auf die eigentümlichsten Einfälle gekommen. Von derartigen Skurrilitäten wimmelt es in Walsers Buch. Bei alledem spricht der Autor sein Programm deutlich aus: Nachdem Walser die Kreuzigung Jesu – beinahe blasphemisch – haarklein beschrieben hat, meint er, der Schriftsteller solle sich nicht ans Großartige schmiegen, sondern in Kleinigkeiten bedeutend werden. Der Autor tändelt mit seiner Intelligenz. Ständig behält er schreibend seinen Leser im Auge – etwa, wenn er einschränkt: falls das nicht übertrieben klingt. Gern spricht er beiseite, überblickt dichtend sein Erlebtes, glaubt, dass er etwas wert sei und dichtet überhaupt verblüffend trocken. Obwohl er spärlich gelesen werde, so ermuntert er sich, gäbe es Leser, die ihn gerade darum schätzten. Sogar um das finanzielle Wohlergehen der bedauernswerten Verleger sorgt sich dieser umsichtige Autor. Jene Herren sollten sich Autoren halten, die im Leben sonst noch etwas sind. Sich und sein Handwerk nimmt der Poet nur so ernst als unbedingt nötig. Mensch sein und spazieren sei genau so schön wie die Buchproduktion (Sonntagsspaziergang (I)). Ein Poet ist er schon, denn er schätzt eingebildetes Leben höher als wirkliches.
Erich
Walser möchte ein großer Dichter sein. Jammerschade, hohe Lieder der Liebe liegen bereits fix und fertig gedichtet vor. Gerne kröche er durchs Lieferantentürli in die Paläste der Literatur . Walser nennt den Helden seiner Kurzgeschichte Erich, weil dieser Vorname so blond sei. In dieser Geschichte wird auch Pieter Maritz, der Burensohn, durch den Kakao gezogen. Maupassant, Graf Villiers de l'Isle-Adam, Dumas, Balzac und Sacher-Masoch, der Schilderer östlicher Eigenart, kommen in der Geschichte Von einigen Dichtern und einer tugendhaften Frau auch nicht viel besser weg. Und wie hält es der Autor mit Kleist, Goethe, Schiller und besonders mit Hölderlin, dem edlen, der am dichtenden Verstummen zugrunde ging? Walser schämt sich seiner guten Laune, wenn er von solchem Großsein schreibt.
Gott und die Welt
- Gott gibt nicht viel, schreibt Walser, wenn er in seinem fünften Lebensjahrzehnt über den Menschen nachdenkt, dem karge siebenzig Jahre zugemessen sind, damit das Wenige etwas bedeute. Für die eigene Person hat Walser diese biblische Norm (Ps 90,10 ) um acht Jahre übertroffen.
- Walser muss nicht extra Geschichten erfinden, um gedruckt zu werden. So greift er einfach eine Meldung aus dem Blätterwald heraus: Lenin verstarb. Schon ist der Bezwinger der Massen für eine Betrachtung Lenin und Christus? gut. Jener revolutionäre Sohn eines Simbirsker Schulinspektors wohnte immerhin reichlich zehn Jahre nach dem ewigen Mieter Walser während des Ersten Weltkriegs in der Spiegelgasse im Zürcher Oberdorf[2].
Die Rose
In der kleinen Szene, die dem Band den Titel gab, schenkt der trotzige Arthur der Kellnerin keine Rose. Die Kellnerin bekommt die Blume von einem anderen und bedauert das: Nicht die Aufmerksamen machen den Frauen Eindruck, sagt sie. Wir schauen achtungsvoll auf Achtlose. Die Beschäftigten, Inanspruchgenommenen gefallen uns.
Der Einsame
Ein poetisches Loblied auf die geistig-moralische Freiheit und Ungebundenheit des Einsamen, Nichtintegrierten.
Zitate
Wörter und Wendungen
- Bildungssprachliches: Walser spielt mit dem Leser, wenn er zum Beispiel schreibt Darüber war die Wirtin intrigiert und vermutlich indigniert meint.[8] Andererseits benutzt Walser gern Helvetismen, Hier kommt intrigieren als Helvetismus von frz. intriguer; cela m'intrigue = das gibt mir zu denken, macht neugierig, beschäftigt mich. Es gab der Wirtin zu denken, sie war nicht indigniert.
- … mit vor Sehnen zu Kreisen geweiteten Augen…[9]
- Nachdem eine Garderobenfrau ihn vertraulich behandelt hat, lodert Walser wie ein Scheit[10].
- brünseln für brunzen [urinieren].[11]
- plakätische [Plakat] Zeiten.[12]
- Der Mann, der gern eine schöne Frau kennenlernen mögen könnte,…[13]
- Kleist ist gemißbilligt worden[14].
- Seine Verse erscheinen aus Gemüt und Verstand herausgenötigt[15].
- das Nichtnotizdavonnehmen, das Verständnisentgegenbringen, das Nichtnachahmenkönnen[16].
- das Vorläufig-alles-dies-noch-nicht-für-möglich-halten-Können[17].
Selbstzeugnis
Walser schreibt im Herbst 1925 an Resy Breitbach: 'Die Rose' ist eines meiner feinsten Bücher… Es ist das ungezogenste, jugendlichste aller meiner Bücher,…[18].
Rezeption
- Greven entdeckt in der 'Rose' wahre Wunder der Sprache[19].
- Zu seiner Zeit war Walser mit seinen aleatorischen Montagen, wie sie in der Rose auffindbar sind, ein Avantgardist[20].
- Die Clownerien Walsers in der Rose, die sprachlichen Extravaganzen, Kalauer, Neologismen und Manieriertheiten [Künsteleien] seien auch Spiegel einer gefährdeten Psyche[21].
Literatur
- Verwendete Ausgabe
- Jochen Greven (Hrsg.): Robert Walser: Die Rose. Mit einem Nachwort des Herausgebers. Zürich 1986. ISBN 3-518-37608-X.
- Sekundärliteratur
- Die Bibel oder die ganze Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments. Revidierte Fassung der deutschen Übersetzung Martin Luthers. Württembergische Bibelanstalt, Stuttgart 1912.
- Gero von Wilpert: Lexikon der Weltliteratur. Deutsche Autoren A–Z. 4. Aufl. Kröner Verlag, Stuttgart 2004, ISBN 3-520-83704-8, S. 648.
- Wolfram Groddeck: Die Rose (1925). In: Lucas Marco Gisi (Hrsg.): Robert Walser-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung, J.B. Metzler, Stuttgart 2015, ISBN 978-3-476-02418-3, S. 175–180.
Einzelnachweise
- Greven, Nachwort, S. 111
- Nachwort, S. 115
- Verwendete Ausgabe, S. 50
- Verwendete Ausgabe, S. 60
- Verwendete Ausgabe, S. 62
- Verwendete Ausgabe, S. 70
- Verwendete Ausgabe, S. 70
- Verwendete Ausgabe, S. 43
- Verwendete Ausgabe, S. 49
- Verwendete Ausgabe, S. 51
- Verwendete Ausgabe, S. 52
- Verwendete Ausgabe, S. 59
- Verwendete Ausgabe, S. 65
- Verwendete Ausgabe, S. 67
- Verwendete Ausgabe, S. 67
- Verwendete Ausgabe, S. 58, 77, 91
- Verwendete Ausgabe, S. 92
- Nachwort, S. 110
- Nachwort, S. 110
- Nachwort, S. 111–112
- Nachwort, S. 110