August Friedrich Pott
August Friedrich Pott (* 14. November 1802 in Nettelrede; † 5. Juli 1887 in Halle (Saale)) war ein deutscher Sprachforscher.
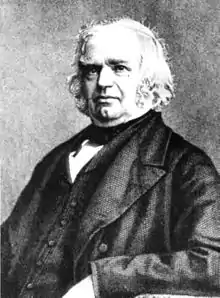
Leben und Werk
Den Sohn eines Predigers befriedigte das Studium der Theologie durchaus nicht, daher widmete er sich an der Universität Göttingen vor allem den Fächern Philologie, Philosophie und Geschichte. Pott studierte insbesondere Hebräisch, Griechisch und Latein, hörte aber auch Physik und Chemie. Er trat eine Stelle als Collaborator am Gymnasium Celle an und promovierte 1827 an der Universität Göttingen mit der Dissertation De relationibus quae praepositionibus in Linguis denotantur. Der Unterricht füllte ihn jedoch nicht aus, so dass er seine sprachwissenschaftlichen Studien (speziell Sanskrit) an der Universität Berlin fortsetzte. Am 1. Mai 1830 habilitierte sich Pott dort, 1833 wurde er zum außerordentlichen Professor der Universität Halle für allgemeine Sprachwissenschaft ernannt und 1838 zum ordentlichen Professor befördert.
Pott las vor allem allgemeine Sprachwissenschaft und Sprachphilosophie sowie historische Grammatik. Außerdem bot er Spezialvorlesungen zum Sanskrit, dem Chinesischen und über Hieroglyphen an. 1845 gründete Pott gemeinsam mit anderen Gelehrten die Deutsche Morgenländische Gesellschaft. Im Zentrum seiner Forschungen standen Probleme der Indogermanistik. Pott wandte die grimmsche Methode der etymologischen Lautvergleichung auf indogermanische Fragen an und entwickelte Methoden zur vergleichenden Analyse der Stammbildung. Seine 1833 erstmals veröffentlichten Etymologische Forschungen (Nachdruck 1999) baute er zu einem sechsbändigen Werk über die indogermanischen Sprachen, insbesondere über das Sanskrit, Griechische, Lateinische, Litauische und Gotische aus (1859–1876). Er veröffentlichte ein dreibändiges Werk über Personen- und Ortsnamen, mehrere Studien über Zahlwörter (1847–1859), die er 1868[1] zusammenfassend dargestellt hat, und ein vorurteilsfreies zweibändiges Werk über Die Zigeuner in Europa und Asien unter Berücksichtigung der damaligen „Gaunersprache“ (1844/45). Einen Überblick über den damaligen Stand der Sprachwissenschaft bietet Potts Einleitung in die allgemeine Sprachwissenschaft (1884).[2]
Immer wieder wandte sich Pott gegen die Instrumentalisierung der Sprachwissenschaft und mystische Deutungen (u. a. Anti-Kaulen: Oder mystische Vorstellungen vom Ursprung der Völker und Sprachen, 1863). So wies er auch Arthur de Gobineaus rassistisch motivierten Versuch über die Ungleichheit der Menschenrassen als nicht hinreichend begründet zurück (Die Ungleichheit menschlicher Rassen hauptsächlich vom sprachwissenschaftlichen Standpunkte, unter besonderer Berücksichtigung von des Grafen von Gobineau gleichnamigen Werke: mit einem Überblick über die Sprachverhältnisse der Völker, ein ethnologischer Versuch, 1856). Potts Pionierleistungen in der Sprachwissenschaft fanden Anerkennung; so erhielt er den Roten Adler-Orden II. Klasse, den russischen Sankt-Stanislaus-Orden I. Klasse mit Band und Stern sowie den Orden Pour le mérite für Wissenschaften und Künste. Ab 1850 war er korrespondierendes und ab 1877 auswärtiges Mitglied der Preußischen Akademie der Wissenschaften. Die Russische Akademie der Wissenschaften nahm ihn 1855 als korrespondierendes Mitglied auf. 1870 ernannte ihn die Bayerische Akademie der Wissenschaften zum auswärtigen Mitglied. 1876 wurde er zum auswärtigen Mitglied der Göttinger Akademie der Wissenschaften gewählt.[3]

1870 erhielt Pott eine Medaille zusammen mit seinen Kollegen Hermann Brockhaus, Heinrich Leberecht Fleischer und Emil Rödiger anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, deren erste Geschäftsführer die Geehrten waren.[4]
Sein Sohn Hermann Richard Pott (1844–1903) machte sich als Mediziner einen Namen.
Sein Vormund[5] und Oheim war Georg Heinrich Deicke, welchem er 1833 sein Werk Etymologische Forschungen auf dem Gebiete der indogermanischen Sprachen widmete.[6]
Literatur
- Gertrud Bense: Bemerkungen zu theoretischen Positionen im Werk von A. F. Pott. In: Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung. Bd. 29, 1976, S. 519–522.
- Gertrud Bense: August Friedrich Pott 1802–1887. In: Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung. Bd. 32, 1979, S. 19–23.
- Karl-Heinz Best: August Friedrich Pott (1802–1887). In: Glottometrics. Bd. 12, 2006, S. 94–96 (behandelt Themen von Pott, die für die Quantitative Linguistik von Bedeutung sind). (PDF Volltext)
- Georg von der Gabelentz: Pott, August Friedrich. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 26, Duncker & Humblot, Leipzig 1888, S. 478–485.
- Joan Leopold: The letter liveth. The life, work and library of August Friedrich Pott (1802–1887). Benjamins, Amsterdam 1983, ISBN 90-272-3733-6.
- Yakov Malkiel: August Friedrich Pott as a Pioneer of Romance Linguistics. In: Kathryn Klar, Margaret Langdon und Shirley Silver (Hrsg.): American Indian and Indoeuropean Studies – Papers in Honor of Madison S. Beeler (= Chiara Gianollo und Daniel Van Olmen [Hrsg.]: Trends in Linguistics. Studies and Monographs [TiLSM]. Band 16). De Gruyter, 1980, S. 409–420.
- Frans Plank: Professor Pott und die Lehre der Allgemeinen Sprachwissenschaft. In: Beiträge zur Geschichte der Sprachwissenschaft. Bd. 3, 1993, S. 95–128.
- Harald Wiese: Eine Zeitreise zu den Ursprüngen unserer Sprache. Wie die Indogermanistik unsere Wörter erklärt. Logos, Berlin 2007, ISBN 978-3-8325-1601-7.
- Rüdiger Schmitt: Pott, August Friedrich. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 20, Duncker & Humblot, Berlin 2001, ISBN 3-428-00201-6, S. 659 f. (Digitalisat).
Weblinks
- Literatur von und über August Friedrich Pott im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Werke von und über August Friedrich Pott in der Deutschen Digitalen Bibliothek
- Eintrag zu August Friedrich Pott im Catalogus Professorum Halensis
- Nachlass von Pott
- Porträt Potts auf den Seiten des Instituts für Indologie der Universität Halle (Memento vom 12. Oktober 2004 im Internet Archive)
- Über Doppelung (Memento vom 9. November 2004 im Internet Archive)
- Potts Werke bei Google Books
Quellen
- Personalakte im Universitätsarchiv Halle: 12595 A. F. Pott
- August F. Pott: Die Sprachverschiedenheit in Europa an den Zahlwörten nachgewiesen sowie quinäre und vigesimale Zählmethode. Halle an der Saale 1868; Neudruck Amsterdam 1971.
- In: Internationale Zeitschrift für allgemeine Sprachwissenschaft. Bd. 1, 1884, S. 1–68 (= Techmers Zeitschrift). Neudruck: John Benjamins, Amsterdam 1974.
- Holger Krahnke: Die Mitglieder der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen 1751–2001 (= Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, Philologisch-Historische Klasse. Folge 3, Bd. 246 = Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, Mathematisch-Physikalische Klasse. Folge 3, Bd. 50). Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2001, ISBN 3-525-82516-1, S. 193.
- Stefan Krmnicek, Marius Gaidys: Gelehrtenbilder. Altertumswissenschaftler auf Medaillen des 19. Jahrhunderts. Begleitband zur online-Ausstellung im Digitalen Münzkabinett des Instituts für Klassische Archäologie der Universität Tübingen (= Von Krösus bis zu König Wilhelm. Neue Serie, Band 3). Universitätsbibliothek Tübingen, Tübingen 2020, S. 35–37 (online).
- Paul Horn: August Friedrich Pott (Reprint aus: Beiträge zur Kunde der indogermanischen Sprachen. Band 13, Göttingen 1888, S. 317.) Online
- August Friedrich Pott: Etymologische Forschungen auf dem Gebiete der indogermanischen Sprachen. Lemgo 1833, Widmung S. III.