Wasser-Schwaden
Der Wasser-Schwaden (Glyceria maxima (Hartm.) Holmbg., Syn.: Glyceria aquatica Wahlenb.), auch Großer Schwaden, Großer Wasserschwaden oder Riesen-Schwaden genannt, gehört zur Familie der Süßgräser. Das üppige „Wassergras“ bildet in sumpfigen Gebieten häufig ausgedehnte Reinbestände.
| Wasser-Schwaden | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Wasser-Schwaden (Glyceria maxima); Abbildung links; rechts Flutender Schwaden (Glyceria fluitans) | ||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Wissenschaftlicher Name | ||||||||||||
| Glyceria maxima | ||||||||||||
| (Hartm.) Holmb. |
Beschreibung
Der Wasser-Schwaden ist eine sehr große, etwa 80 bis 150, zuweilen bis zu 200 Zentimeter hohe, ausdauernde krautige Pflanze mit weit kriechenden, kräftigen Rhizomen. Er bildet ausgedehnte Sprosskolonien mit zahlreichen nicht blühenden, kräftigen und aufrechten vegetativen Trieben. Die Halme sind rund und bis zu 1 Zentimeter im Durchmesser. Die Blätter sind kahl und rau. Die Blattscheiden sind geschlossen, später aufreißend und nur oben etwas gekielt, ohne Öhrchen. Die gefalteten bis flachen Blattspreiten werden bis zu 60 Zentimeter lang und 7 bis 20 Millimeter breit. Das Blatthäutchen (Ligula) ist 1 bis 3 Millimeter lang, abgerundet bis gestutzt und meist in eine feine Spitze ausgezogen.
 Blatthäutchen (Ligula) des Wasser-Schwadens
Blatthäutchen (Ligula) des Wasser-Schwadens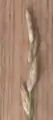 Ährchen des Wasser-Schwadens
Ährchen des Wasser-Schwadens

Die Blütenrispen sind groß etwa 20 bis 40 Zentimeter lang, ausgebreitet und offen, nach der Blüte zusammengezogen. Die Rispenäste sind rau und stehen in Büscheln. Die 5 bis 10 Millimeter langen Ährchen sind schmal länglich und fünf- bis elfblütig. Die untere Hüllspelze ist 2 bis 3 Millimeter, die obere 3 bis 4 Millimeter lang. Die Deckspelzen sind auf den Rücken gerundet, breit eiförmig, stumpf und grannenlos. Der Wasser-Schwaden blüht in der Zeit von Juni bis August.
Die Chromosomenzahl beträgt 2n = 60.[1]
Ökologie

Der Wasserschwaden ist eine Sumpfpflanze, ein Schlammwurzler und eine Schaftpflanze. Vegetative Vermehrung erfolgt durch unterirdische Ausläufer sowie gelegentlich durch Pseudoviviparie.[2]
Blütenbiologisch liegt Windblütigkeit vom „langstaubfädigen Typ“ vor. Zellsaftschwankungen in den Gelenken der Rispenäste sorgen dafür, dass diese vor und nach der Blüte anliegen.[2]
Die freien, unbenetzbaren Karyopsen, bei denen meist Schwimmausbreitung erfolgt, können auch durch Klebausbreitung mit dem Schlamm, über Wasservögel und durch Viehtränkenbesucher weiter getragen werden.[2]
Vorkommen
.jpg.webp)
Die Pflanze ist in weiten Teilen Europas und im gemäßigten Asien bis ins nordwestliche China heimisch und nach Australien, Neuseeland und Nordamerika eingeführt.[3] Sie wird dort auch „Reed Meadow-grass“, „Reed-grass“ oder „Reed“ genannt. Die Art ist in ganz Deutschland häufig.
Der Wasser-Schwaden wächst gesellig als Röhricht an Ufern oder in Gräben mit stehendem oder langsam fließendem Wasser und stark wechselnden Wasserständen. Er bevorzugt nährstoff- und basenreiche, meist kalkhaltige, humose Schlammböden und ist licht- und wärmeliebend.
Der Wasser-Schwaden ist die Kennart der Pflanzengesellschaft des Wasserschwaden-Röhrichts (Glycerietum maximae). Die Bestände sind meist artenarm und bestehen nicht selten aus Reinbeständen von Glyceria maxima. An höher gelegenen Stellen sind die Gesellschaften etwas artenreicher und beinhalten die Sumpf-Schwertlilie (Iris pseudacorus), das Rohr-Glanzgras (Phalaris arundinacea), den Fluss-Ampfer (Rumex hydrolapathum) und Wasser-Minze (Mentha aquatica).
Nutzung
Der Wasser-Schwaden ist eine nahrhafte Futterpflanze und wird gern von Rindern und Pferden gefressen. An Flussufern ist es zur Eindämmung von Erosionen geeignet.
In Gärten und Parks wird die Zuchtform Glyceria maxima 'Variegata' mit grün und fahlgelb gestreiften, etwas überhängenden Blättern für die Pflanzung an Zierteichen eingesetzt.
Literatur
- Erich Oberdorfer: Pflanzensoziologische Exkursionsflora. Unter Mitarbeit von Theo Müller. 7., überarbeitete und ergänzte Auflage. Eugen Ulmer, Stuttgart (Hohenheim) 1994, ISBN 3-8252-1828-7.
- Henning Haeupler, Thomas Muer: Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands. Hrsg.: Bundesamt für Naturschutz (= Die Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands. Band 2). Eugen Ulmer, Stuttgart (Hohenheim) 2000, ISBN 3-8001-3364-4.
- Charles Edward Hubbard: Gräser. Beschreibung, Verbreitung, Verwendung (= UTB. Band 233). 2., überarbeitete und ergänzte Auflage. Eugen Ulmer, Stuttgart (Hohenheim) 1985, ISBN 3-8001-2537-4 (englisch: Grasses. Übersetzt von Peter Boeker).
Einzelnachweise
- Erich Oberdorfer: Pflanzensoziologische Exkursionsflora für Deutschland und angrenzende Gebiete. 8. Auflage. Stuttgart, Verlag Eugen Ulmer, 2001. ISBN 3-8001-3131-5. Seite 219.
- Ruprecht Düll, Herfried Kutzelnigg: Taschenlexikon der Pflanzen Deutschlands und angrenzender Länder. Die häufigsten mitteleuropäischen Arten im Porträt. 7., korrigierte und erweiterte Auflage. Quelle & Meyer, Wiebelsheim 2011, ISBN 978-3-494-01424-1, S. 369.
- Rafaël Govaerts (Hrsg.): Glyceria maxima. In: World Checklist of Selected Plant Families (WCSP) – The Board of Trustees of the Royal Botanic Gardens, Kew, abgerufen am 25. Mai 2020.
Weblinks
- Wasser-Schwaden. FloraWeb.de
- Wasser-Schwaden. In: BiolFlor, der Datenbank biologisch-ökologischer Merkmale der Flora von Deutschland.
- Steckbrief und Verbreitungskarte für Bayern. In: Botanischer Informationsknoten Bayerns.
- Glyceria maxima (Hartm.) Holmb. In: Info Flora, dem nationalen Daten- und Informationszentrum der Schweizer Flora.
- Verbreitung auf der Nordhalbkugel aus: Eric Hultén, Magnus Fries: Atlas of North European vascular plants. 1986, ISBN 3-87429-263-0 bei Den virtuella floran. (schwed.)
- Thomas Meyer: Datenblatt mit Bestimmungsschlüssel und Fotos bei Flora-de: Flora von Deutschland (alter Name der Webseite: Blumen in Schwaben)