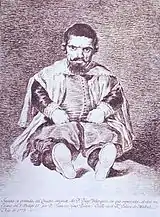Sebastián de Morra
Don Sebastián de Morra (17. Jahrhundert, genaue Lebensdaten unbekannt) war ein Hofzwerg und gehörte zur höfischen Entourage König Philipps IV. von Spanien. Er wurde von dem Hofmaler Diego Velázquez porträtiert und wird allgemein mit seinem berühmten Gemälde Zwerg, auf dem Boden sitzend im Prado identifiziert.[2]
Das Porträt von Velázquez
_-_WGA24419.jpg.webp)
Am Hofe Philipps IV. hielt sich eine ganze Reihe von Hofnarren und Zwergen auf; berichtet wird, der zur Schwermut neigende Herrscher habe ohne diese Spaßmacher weder essen noch trinken können,[3] wobei allerdings nicht alle Hofzwerge auch Narren waren. Velázquez hat mehrere von ihnen porträtiert, und obwohl er insbesondere die Narren teilweise in Verkleidung, in einer typischen Rolle oder während einer typischen Beschäftigung malte (den Zwerg Francisco Lescano stellte er z. B. mit Kartenspiel in den Händen dar),[4] zeigen seine Zwergenporträts im Gegensatz zu den später als Callotti berühmt gewordenen grotesken Figuren Callots (Varie Figure Gobbi, Florenz 1616)[5] „keinerlei karikaturhafte Züge und keinerlei Überbetonung des Burlesken“.[6]
Von dem hier besprochenen Gemälde existieren zwei Versionen: eine im Prado, und eine zweite in einer Privatsammlung, die vielleicht mit Werkstattbeteiligung angefertigt wurde und sich von der Pradoversion vor allem im Detail eines Kruges und eines angedeuteten Fensters am rechten Bildrand unterscheidet.[7] Eine eindeutige Identifikation des Dargestellten ist nicht möglich, laut Inventaren des Marquis von Carpio, in dessen Besitz sich die zweite Version früher befand, handelt es sich stattdessen um einen anderen aus den Akten bekannten Hofzwerg: Diego de Acedo, gen. El Primo, der ebenfalls von Velázquez gemalt wurde, der jedoch traditionell mit einem anderen bekannten Gemälde identifiziert wird, auf dem ein Zwerg mit Büchern zu sehen ist (ca. 1644, Prado, Madrid; siehe unten) – auch diese Identifizierung ist zweifelhaft und stammt aus dem 19. Jahrhundert.[8] Der hier dargestellte Hofzwerg erscheint darüber hinaus auch auf Velázquez' Gemälde Prinz Baltasar Carlos mit Conde Ducque de Olivares in der Reitschule von 1636 (Sammlung des Duke of Westminster, London).[9]
Auffällig an dem Porträt ist die große Unmittelbarkeit und Direktheit der Darstellung. Der Körper des kleinen Mannes nimmt einen Großteil der Leinwand ein, was zu einem Eindruck einer quasi „monumentalen Erscheinung“ beiträgt;[10] allerdings waren die originalen Dimensionen des Bildes im Prado ursprünglich anders, es wurde später laut López-Rey vor allem am rechten Rand „beträchtlich beschnitten“.[11] Hintergrund und Raum bleiben in der Pradoversion völlig unbestimmt. Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht der ernste, wache, intensive, aber auch etwas düstere Blick, mit dem er den Betrachter ganz unvermittelt anblickt. Der Kopf ist leicht zur Seite geneigt. Der Kleinwuchs des auf diesem Porträt Dargestellten entspricht medizinisch einer Achondroplasie, mit mehr oder weniger normal proportioniertem Oberkörper, aber zu kurzen und teils deformierten Extremitäten. Seine Sitzhaltung mit den vorgestreckten kurzen Beinen und den von unten sichtbaren nach oben zeigenden Fußsohlen erinnert ein wenig an eine Puppe oder Marionette. Seine Hände liegen als Fäuste auf seinem Schoß. Dieses Detail zusammen mit dem intensiven Blick verleihen dem Porträt eine gewisse „reizbare“[12] oder leicht aggressive Note – zumindest eine gewisse gespannte Dynamik. Die 'Missgestalt' des Zwergs wird durch diese besondere Sitzhaltung, durch die man Länge und Form der Beine nicht genau erkennen kann, zugleich diskret und geschickt kaschiert. Der leuchtend rote, mit Gold besetzte Umhang über grünem Rock verleiht der Figur eine auffällig farbenfrohe Note, die untypisch für die normale spanische Hoftracht ist, und sich im Vergleich mit dem häufig rein schwarz oder zumindest dunkel gekleideten Personal auf anderen zeitgenössischen spanischen Porträts deutlich absetzt (auch auf dem genannten Bildnis von Prinz Baltasar Carlos ...in der Reitschule (1636) trägt der Hofzwerg Rot). Die Farbgebung, besonders das Rot, trägt zu dem intensiven Gesamteindruck bei. Wie das gesamte Porträtschaffen von Velázquez, bringt auch dieses Bild zusammen mit seinem Porträt des Hofzwerges Diego de Acedo, gen. El Primo (ca. 1644, Prado, Madrid), „die Schärfe seines Charakterisierungsvermögens voll zur Geltung“.[13]
.jpg.webp) Diego Velázquez: Zwerg ein Buch auf den Knien haltend, (auch bekannt als: Don Diego de Acedo, gen. „el Primo“)[14] (Museo del Prado, Madrid)
Diego Velázquez: Zwerg ein Buch auf den Knien haltend, (auch bekannt als: Don Diego de Acedo, gen. „el Primo“)[14] (Museo del Prado, Madrid)
Rezeption
Aus dem Jahre 1778 stammt eine Radierung von Francisco de Goya, die der Künstler nach dem Gemälde des Kollegen im Prado angefertigt hatte. Der Zwerg erscheint bei Goya mit einem veränderten Gesichtsausdruck: weniger ernst und konzentriert, stattdessen mit weit aufgerissenen Augen, die ins Nichts zu starren scheinen. Die bereits im Original vorhandene, von López-Rey erwähnte leicht 'reizbare' Note wurde durch Goya betont. Laut Ansicht eines Interpreten, liefere Goyas Darstellung einen „Eindruck von der Dinglichkeit des Wesens“, und eine tiefere „Auseinandersetzung mit der menschlichen Problematik der missgestalteten Geschöpfe“[16] – eine Interpretation, die angesichts der feinen und von Klischees völlig freien Charakterzeichnung auf dem Original von Velázquez zumindest zweifelhaft erscheint. Die von Goya angebrachten Veränderungen im Ausdruck des kleinwüchsigen Mannes spiegeln eher „Goyas Interesse für die Grenzbereiche des menschlichen Daseins“,[17] und rücken auch bereits einige seiner 'Leitmotive', wie „Narrheit“ und das „Abgründige“, ins Blickfeld.[18]
Salvador Dalí zitierte im Jahre 1982 das Werk des berühmten Kollegen Velázquez in einer Serie von Bildern in unterschiedlichen Techniken. Ein Ölgemälde mit Collage zeigt den Hofzwerg vor dem Hintergrund des Escorial, der königlichen Residenz, mit Spiegeleiern auf dem Kopf, auf den Schultern und auf den Händen, es trägt den Titel: Hinter dem Fenster linker Hand, dort, wo ein Löffel hervorkommt, liegt Velázquez im Sterben. Abgesehen von spitzfindigen surrealistischen oder anderen Interpretationen ist es denkbar, dass Dalí den Hofzwerg als Objekt von Demütigung, Clownerien und Respektlosigkeit zeigen wollte. Es handelt sich jedoch nur um eine persönliche Interpretation von Dalí.
Ob die Neuinterpretationen von Goya und Dalí dem dargestellten Mann und der historischen Realität gerecht werden, kann nur schwer oder gar nicht ermittelt werden, da über Sebastián de Morra – wenn es sich überhaupt um ihn handelt – zu wenig bekannt ist.
Einzelnachweise
- José Lopez-Rey: Velázquez – Sämtliche Werke, Wildenstein Institute /Benedikt Taschen-Verlag, Köln 1997: S. 134.
- José Lopez-Rey: Velázquez – Sämtliche Werke, Wildenstein Institute /Benedikt Taschen-Verlag, Köln 1997: S. 134.
- Carl Justi: Diego Velázquez und sein Jahrhundert (1888), S. 567
- José Lopez-Rey: Velázquez – Sämtliche Werke, …, Köln 1997: S. 128–139.
- Dirk Syndram & Ulrike Weinhold: „...und ein Leib von Perl“ – die Sammlung der barocken Perlfiguren im Grünen Gewölbe", Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Edition Minerva, Wolfratshausen 2007, S. 18–21
- José Lopez-Rey: Velázquez – Sämtliche Werke, …, Köln 1997: S. 134.
- José Lopez-Rey: Velázquez – Sämtliche Werke, …, Köln 1997: S. 134, 263.
- José Lopez-Rey: Velázquez – Sämtliche Werke, …, Köln 1997: S. 133–134, 136.
- José Lopez-Rey: Velázquez – Sämtliche Werke, …, Köln 1997: S. 116 und 138.
- José Lopez-Rey: Velázquez – Sämtliche Werke, …, Köln 1997: S. 134.
- José Lopez-Rey: Velázquez – Sämtliche Werke, …, Köln 1997: S. 134.
- José Lopez-Rey: Velázquez – Sämtliche Werke, …, Köln 1997: S. 134.
- „Velázquez, Diego Rodriguez de Silva y“, in: Lexikon der Kunst, Bd. 12 (Tou-Zyp), hrg. v. Wolf Stadler u. a., Karl Müller Verlag, Erlangen 1994, S. 113–123, hier: 120–121
- In Wirklichkeit ist auch hier keine eindeutige Identifizierung möglich, siehe: José Lopez-Rey: Velázquez – Sämtliche Werke, Wildenstein Institute /Benedikt Taschen-Verlag, Köln 1997: S. 133–134, 136.
- Legende (s. Goya, 1980): Sacada y gravada del Quadro original de D. Diego Velazquez en que representa al vivo un/Enano del S. Phelipe IV. por D. Francisco Goya Pintor. Existe en el R. Palacio de Madrid/Aňo de 1778. (Radiert nach der Vorlage des Originalgemäldes von D. Diego Velázquez, das einen Zwerg König Philipps IV. nach dem Leben darstellt. Von D. Francisco Goya, Maler. Es befindet sich im kgl. Palast zu Madrid. Im Jahre 1778)
- Goya. Das Zeitalter der Revolutionen. 1789–1830. München 1980; S. 250
- „Goya y Lucientes, Francisco José de“, in: Lexikon der Kunst, Bd. 5 (Gal-Herr), hrg. v. Wolf Stadler u. a., Karl Müller Verlag, Erlangen 1994, S. 182–187, hier: S. 184.
- „Goya y Lucientes, Francisco José de“, in: Lexikon der Kunst, Bd. 5 (Gal-Herr), hrg. v. Wolf Stadler u. a., Karl Müller Verlag, Erlangen 1994, S. 182–187, hier: S. 185.
Literatur
- „Goya y Lucientes, Francisco José de“, in: Lexikon der Kunst, Bd. 5 (Gal-Herr), hrg. v. Wolf Stadler u. a., Karl Müller Verlag, Erlangen 1994, S. 182–187.
- Goya. Das Zeitalter der Revolutionen. 1789–1830. München 1980; S. 250
- Carl Justi: Diego Velázquez und sein Jahrhundert. (1888), München [1982]
- José Lopez-Rey: Velázquez – Sämtliche Werke, Wildenstein Institute /Benedikt Taschen-Verlag, Köln 1997: S. 116 (Bild), S. 131, 133–136 (Zwergenporträts), 138–139 (Bilder), 261–263 (Katalog).
- „Velázquez, Diego Rodriguez de Silva y“, in: Lexikon der Kunst, Bd. 12 (Tou-Zyp), hrg. v. Wolf Stadler u. a., Karl Müller Verlag, Erlangen 1994, S. 113–123
- Franz Zelger: Diego Velázquez. Reinbek 1994; S. 70f.
.jpg.webp)